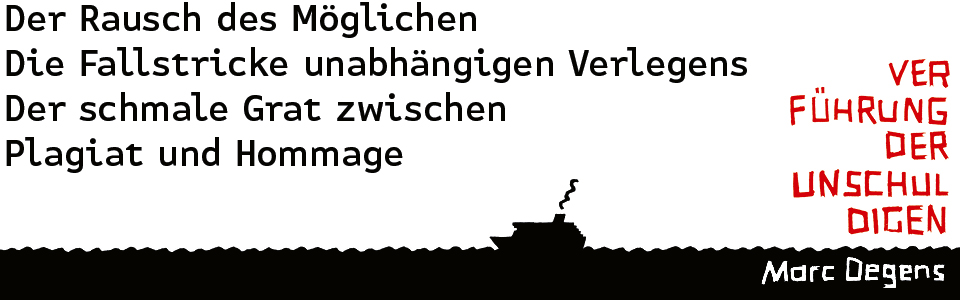
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
31. Januar 2010 italo.log Die wöchentliche Gedichtanthologie aus Italien. Herausgegeben von Roberto Galaverni und Theresia Prammer. » Kontakt » Zum Geleit ... » bis 111: Andrea Ponso 110: Paolo Bertolani 109: Andrea Temporelli 108: Ermanno Krumm 107: Patrizia Cavalli (3) 106: Vivian Lamarque 105: Giancarlo Majorino 104: Toti Scialoja 103: Emilio Rentocchini 102: Eugenio Montale (4) 101: Maria Luisa Spaziani 100: Ignazio Buttita 099: Simone Cattaneo 098: Nanni Balestrini 097: Nino Pedretti 096: Marco Giovenale 095: Valentino Zeichen 094: Elio Pagliarani 093: Bartolo Cattafi 092: Luciano Cecchinel 091: Eugenio de Signoribus 090: Guido Ceronetti 089: Andrea Zanzotto (4) 088: Matteo Marchesini 087: Nicola Gardini 086: Attilio Bertolucci (2) 085: Flavio Santi 084: Gesualdo Bufalino 083: Gherardo Bortolotti 082: Giuliano Mesa 081: Albino Pierro 080: Beppe Salvia 079: Ottiero Ottieri 078: Eugenio Montale (3) 077: Antonio Riccardi 076: Amelia Rosselli (2) 075: Nelo Risi 074: David Maria Turoldo 073: Pier Paolo Pasolini (3) 072: Franco Scataglini 071: Patrizia Vicinelli 070: Milo de Angelis (2) 069: Umberto Piersanti 068: Giorgio Orelli 067: Elisa Biagini 066: Remo Pagnanelli (2) 065: Carlo Bettocchi 064: Vittorio Sereni (2) 063: Giorgio Bassani 062: Federico Italiano 061: Gabriele Frasca 060: Andrea Zanzotto (3) 059: Patrizia Cavalli (2) 058: Antonio Porta 057: Vincenzo Frungillo 056: Gianni D'Elia 055: Gregorio Scalise 054: Giorgio Caproni (2) 053: Stefano Dal Bianco 052: Biagio Marin 051: Elsa Morante 050: Franco Buffoni 049: Franco Loi (2) 048: Ferruccio Benzoni 047: Eugenio Montale (2) 046: Adriano Spatola 045: Dario Bellezza 044: Tonino Guerra 043: Luciano Erba 042: Jolanda Insana 041: Mario Luzi 040: Primo Levi 039: Valerio Magrelli (2) 038: Paolo Volponi 037: Alda Merini 036: Pier Paolo Pasolini (2) 035: Patrizia Valduga 034: Aldo Nove 033: Raffaello Baldini 032: Maurizio Cucchi 031: Piero Bigongiari 030: Andrea Zanzotto (2) 029: Gerhard Kofler 028: Remo Pagnanelli 027: Andrea Gibellini 026: Fabio Pusterla 025: Michele Sovente 024: Anna Maria Carpi 023: Gian Mario Villalta 022: Edoardo Sanguineti 021: Roberto Roversi 020: Patrizia Cavalli 019: Giuseppe Conte 018: Giovanni Giudici 017: Valerio Magrelli 016: Giorgio Caproni 015: Andrea Zanzotto 014: Attilio Bertolucci 013: Emilio Villa 012: Giampiero Neri 011: Giovanni Raboni 010: Amelia Rosselli 009: Sandro Penna 008: Antonella Anedda 007: Pier Paolo Pasolini 006: Fernando Bandini 005: Milo de Angelis 004: Vittorio Sereni 003: Franco Fortini 002: Franco Loi 001: Eugenio Montale satt.org-Links: Latin.Log Gedichte aus Lateinamerika (2005-2008). Herausgegeben von Timo Berger und Rike Bolte. Lyrik.Log Die Gedichtanthologie (2003-2005). Herausgegeben von Ron Winkler. |
|
Ignazio Buttita wurde 1899 in Bagheria (Sizilien) geboren und starb 1997 in seinem Geburtsort. Buttitta nahm am ersten Weltkrieg teil und trat der sozialistischen Bewegung bei. Neben der Aushilfe im Lebensmittelgeschäft seiner Eltern, beginnt er in den frühen 20er Jahren Gedichte in seiner Muttersprache Sizilianisch zu schreiben. Sein erster Band, Sintimintali, erschien 1923 in Palermo, nach dem Erscheinen des zweiten Bandes, Marabedda (Palermo, 1928), zog Buttitta aus beruflichen Gründen nach Mailand. Während des 2. Weltkriegs aufgrund seiner antifaschistischen Haltung in Mailand nicht mehr geduldet, trat er der „Resistenza“ bei, wurde verhaftet und fast verurteilt. Er kehrte zurück nach Mailand, wo er Kontakt zu anderen Schriftstellern mit sizilianischen Wurzeln pflegte, z.B. Elio Vittorini, Salvatore Quasimodo oder Renato Guttuso. Weitere wichtige Gedichtbände, u.a.: Lu pani si chiama pani (Rom, 1954), La peddi nova (Mailand, 1963), Il poeta in piazza (Mailand, 1974), Le pietre nere (Mailand, 1983). Für seinen Band Io faccio il poeta (Mailand, 1972) erhielt Buttitta den Premio Viareggio. Auch Autoren wie Leonardo Sciascia oder Pier Paolo Pasolini schätzten den für die Bewahrung des Sizilianischen eintretenden Schriftstellerkollegen. |
Leopold Federmair über Ignazio Buttita:
Pier Paolo Pasolini stellt die – wie man einst sagte – sozial engagierten Dichtungen von Ignazio Buttita in die Nachbarschaft des russischen Suprematismus und des sozialistischen Realismus. Der sizilianische Dialektdichter und der aus dem Friaul, als Filmregisseur eine Weltberühmtheit, schätzten einander, und wenn Pasolini anmerkt, sein Freund und Kollege habe sich gern auf kommunistischen Tribünen bewegt, so ist dies keineswegs als Schelte gedacht, auch wenn ein leiser Vorbehalt mitschwingen mag. Tatsache ist, daß der 1899 geborene Buttita als halbes Kind im ersten Weltkrieg kämpfen mußte, und Tatsache, daß ihn die Oktoberrevolution mächtig beeindruckte, wie so viele andere auch (zum Beispiel den im selben Jahr geborenen, damals in Genf lebenden Jorge Luis Borges, dessen frühe Verse, die Roten Rhythmen, man ebenfalls suprematistisch nennen könnte). Tatsache ist, daß Buttita gegen das faschistische Regime aufbegehrte, und Tatsache, daß seine antifaschistischen Gedichte in der kommunistischen Monatsschrift Rinascita erschienen und sein erster „überregionaler“ Gedichtband (Lu pani si chiama pani, 1954) vom PCI finanziert wurde. In der Emigration in der Lombardei pflegte Buttita Umgang mit zwei Autoren, die engere Landsleute und Parteimitglieder waren: Elio Vittorini und Salvatore Quasimodo, der einige seiner Gedichte ins Italienische übersetzte.
Salvatore D’Onofrio und Nina Bernardi, zwei Schüler des Anthropologen Antonino Buttita, Ignazios Sohn, unterstreichen in deutlichem Kontrast zu Pasolini das romantische Fundament von Ignazios Dichtung, indem sie den Nachtigallengesang beschwören. Mag sein, daß Pasolinis scharfsichtige Beobachtungen der ureigenen und urtümlichen Musik, die Buttitas Verse aus dem – in nördlicheren Ohren – dunkel klingenden sizilianischen Dialekt beziehen, nicht gerecht werden; daß diesen Bemerkungen etwas fehlt, das er, Pasolini, in seinem Todesjahr (1975), als er die letzten verbitterten Freibeuterschriften ins Publikum warf, nicht mehr zu hören – oder zu benennen? - vermochte, obwohl er, wie er sagte, zu seinem eigenen Dialekt und damit zu seinen poetischen Ursprüngen zurückgekehrt war.
(In Vorbereitung: Pier Paolo Pasolini, Über den sizilianischen Dialektdichter Ignazio Buttita, Salzburg, Tartin Editionen 2010, hrsg. und übersetzt von Leopold Federmair.)
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

