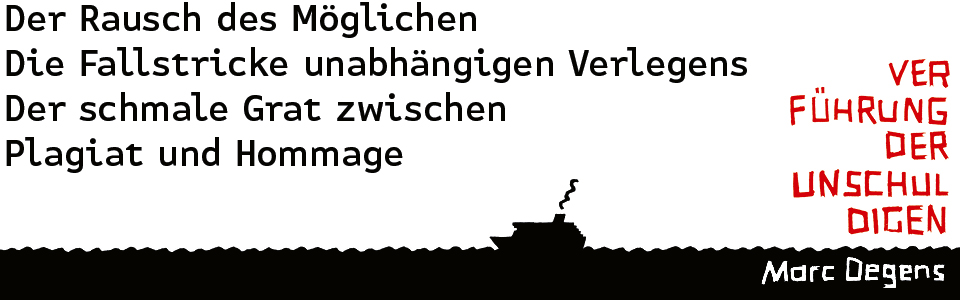
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
9. März 2008 italo.log Die wöchentliche Gedichtanthologie aus Italien. Herausgegeben von Roberto Galaverni und Theresia Prammer. » Kontakt » Zum Geleit ... » bis 111: Andrea Ponso 110: Paolo Bertolani 109: Andrea Temporelli 108: Ermanno Krumm 107: Patrizia Cavalli (3) 106: Vivian Lamarque 105: Giancarlo Majorino 104: Toti Scialoja 103: Emilio Rentocchini 102: Eugenio Montale (4) 101: Maria Luisa Spaziani 100: Ignazio Buttita 099: Simone Cattaneo 098: Nanni Balestrini 097: Nino Pedretti 096: Marco Giovenale 095: Valentino Zeichen 094: Elio Pagliarani 093: Bartolo Cattafi 092: Luciano Cecchinel 091: Eugenio de Signoribus 090: Guido Ceronetti 089: Andrea Zanzotto (4) 088: Matteo Marchesini 087: Nicola Gardini 086: Attilio Bertolucci (2) 085: Flavio Santi 084: Gesualdo Bufalino 083: Gherardo Bortolotti 082: Giuliano Mesa 081: Albino Pierro 080: Beppe Salvia 079: Ottiero Ottieri 078: Eugenio Montale (3) 077: Antonio Riccardi 076: Amelia Rosselli (2) 075: Nelo Risi 074: David Maria Turoldo 073: Pier Paolo Pasolini (3) 072: Franco Scataglini 071: Patrizia Vicinelli 070: Milo de Angelis (2) 069: Umberto Piersanti 068: Giorgio Orelli 067: Elisa Biagini 066: Remo Pagnanelli (2) 065: Carlo Bettocchi 064: Vittorio Sereni (2) 063: Giorgio Bassani 062: Federico Italiano 061: Gabriele Frasca 060: Andrea Zanzotto (3) 059: Patrizia Cavalli (2) 058: Antonio Porta 057: Vincenzo Frungillo 056: Gianni D'Elia 055: Gregorio Scalise 054: Giorgio Caproni (2) 053: Stefano Dal Bianco 052: Biagio Marin 051: Elsa Morante 050: Franco Buffoni 049: Franco Loi (2) 048: Ferruccio Benzoni 047: Eugenio Montale (2) 046: Adriano Spatola 045: Dario Bellezza 044: Tonino Guerra 043: Luciano Erba 042: Jolanda Insana 041: Mario Luzi 040: Primo Levi 039: Valerio Magrelli (2) 038: Paolo Volponi 037: Alda Merini 036: Pier Paolo Pasolini (2) 035: Patrizia Valduga 034: Aldo Nove 033: Raffaello Baldini 032: Maurizio Cucchi 031: Piero Bigongiari 030: Andrea Zanzotto (2) 029: Gerhard Kofler 028: Remo Pagnanelli 027: Andrea Gibellini 026: Fabio Pusterla 025: Michele Sovente 024: Anna Maria Carpi 023: Gian Mario Villalta 022: Edoardo Sanguineti 021: Roberto Roversi 020: Patrizia Cavalli 019: Giuseppe Conte 018: Giovanni Giudici 017: Valerio Magrelli 016: Giorgio Caproni 015: Andrea Zanzotto 014: Attilio Bertolucci 013: Emilio Villa 012: Giampiero Neri 011: Giovanni Raboni 010: Amelia Rosselli 009: Sandro Penna 008: Antonella Anedda 007: Pier Paolo Pasolini 006: Fernando Bandini 005: Milo de Angelis 004: Vittorio Sereni 003: Franco Fortini 002: Franco Loi 001: Eugenio Montale satt.org-Links: Latin.Log Gedichte aus Lateinamerika (2005-2008). Herausgegeben von Timo Berger und Rike Bolte. Lyrik.Log Die Gedichtanthologie (2003-2005). Herausgegeben von Ron Winkler. |
|
Franco Fortini (Pseudonym für Franco Lattes), wurde 1917 in Florenz geboren, wo er auch studierte. Franco Fortini war Autor, Kritiker, politischer Denker, Übersetzer (Goethe, Artaud, Proust, Brecht, Kafka usw.), Verlagsbeauftragter und Professor für Literaturkritik an der Universität Siena. Er starb 1994 in Mailand. Zahlreiche Lyrikbände seit den frühen 50er Jahren, z. B.: Foglio di via e altri versi (Torino, 1946), Agonia di Natale (Torino, 1948), Dieci inverni (1947-1957) (Milano, 1957), Poesia ed errore (1937-1957) (Milano, 1959), Verifica dei poteri (Milano, 1965), L'ospite ingrato (Bari, 1966), I cani del Sinai (Bari, 1967), Composita solvantur (Torino, 1995), Il ladro di ciliege (Torino, 1983), Composita solvantur (Torino, 1994). In deutscher Übersetzung bislang erschienen: 1963 der Band Poesie, aus dem Italienischen von Hans Magnus Enzensberger sowie 2002 Composita Solvantur, deutsch von Manfred Bauschulte. |
Roberto Galaverni schreibt über dieses Gedicht:
Charakteristisch für Fortini ist die ständige wechselseitige Durchdringung von Dichter und Kritiker. Im vorliegenden Fall entspricht der ausgebliebenen Nähebeziehung zu Sabas Versen das umfassende Verkennen und die Entfernung von seiner Dichtung. Die Erinnerung schweift zu einem Saba-Vers, doch es fehlt eine Silbe. Die Rechnung ist nicht aufgegangen, geht immer noch nicht auf. Silbe – Saba: diese Silbe (sillaba) enthält, buchstäblich, den ganzen Dichter. Wie viele Jahre es mir schwer fiel, ihn zu lieben, schreibt Fortini; zugleich – so läßt es sich wohl lesen – Saba und seinen Vers, die Saba-Silbe verfehlend. So hat dieses doch etwas von einer Schranke, die sich zwischen Fortini und den spezifischen Wirklichkeitshorizont schiebt, von dem Sabas Dichtung herrührte. Fortini kann gar nicht anders, als sich gegen Vers und Dichtung Sabas zu verschließen, wenn er die Wirklichkeit, der dieses poetische Wort Ausdruck gibt, nicht zu begreifen oder zu deuten vermag. Sagen wir also: Saba zu begegnen, durch das Auffinden der fehlenden Silbe den exakten Vers und zugleich die Dichtung Sabas zu erkennen, käme dem Nachvollzug der Wahrheit des anfänglichen Bildes gleich und somit jener primären Wirklichkeits-Ebene, jener elementar lebensnahen Ebene, die in der neueren italienischen Dichtung vor allem mit Saba gleichgesetzt wird. Im Grunde, so könnte man einwenden, eine geläufige Konstellation für einen Dichter, und eine Errungenschaft in Sachen Anschauung oder Erkenntnis hat nur dann Bestand, wenn sie mit der Errungenschaft eines bestimmten Verses einhergeht. Doch es liegt auf der Hand, daß diese Wechselseitigkeit bei Saba nicht nur mehr als bei jedem anderen zwingend ist, sondern als Kondition seiner Dichtung tout court gesetzt werden kann. Löst man sie aus dieser grundlegenden Verklammerung heraus, wird seine Poesie unverständlich wie sonst kaum eine, ihrer Legitimität und inneren Notwendigkeit beraubt. Gerade darum kann die Entdeckung des Saba’schen Verses und seiner Richtigkeit-Berechtigung für den gealterten Fortini nicht unabhängig von einer neuen Durchdringung der Wirklichkeit (oder gar, diesmal auch bei ihm, des Daseins) erfolgen. Welche Tragweite und welche umfassende Bedeutung auch immer man ihr geben will: Fortinis Kon-version (das plötzliche Zusammenstimmen mit dem Saba’schen Vers) muß auf der ganzen Linie als Konversion verstanden werden (Bekehrung eines Menschen, in diesem Fall zu einer bestimmten Lebensweise, einem bestimmten Lebensvers).
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

