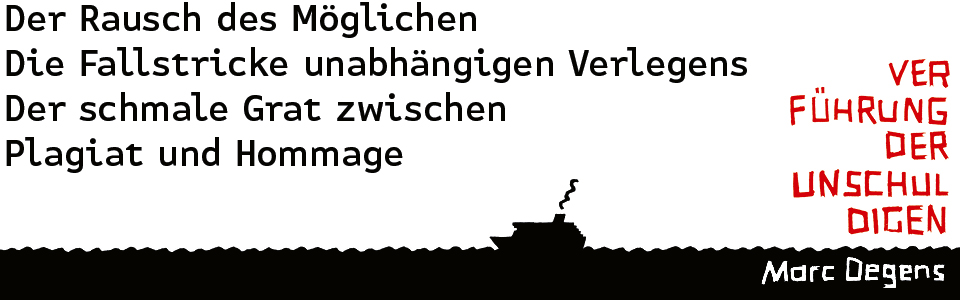
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
10. Mai 2009 italo.log Die wöchentliche Gedichtanthologie aus Italien. Herausgegeben von Roberto Galaverni und Theresia Prammer. » Kontakt » Zum Geleit ... » bis 111: Andrea Ponso 110: Paolo Bertolani 109: Andrea Temporelli 108: Ermanno Krumm 107: Patrizia Cavalli (3) 106: Vivian Lamarque 105: Giancarlo Majorino 104: Toti Scialoja 103: Emilio Rentocchini 102: Eugenio Montale (4) 101: Maria Luisa Spaziani 100: Ignazio Buttita 099: Simone Cattaneo 098: Nanni Balestrini 097: Nino Pedretti 096: Marco Giovenale 095: Valentino Zeichen 094: Elio Pagliarani 093: Bartolo Cattafi 092: Luciano Cecchinel 091: Eugenio de Signoribus 090: Guido Ceronetti 089: Andrea Zanzotto (4) 088: Matteo Marchesini 087: Nicola Gardini 086: Attilio Bertolucci (2) 085: Flavio Santi 084: Gesualdo Bufalino 083: Gherardo Bortolotti 082: Giuliano Mesa 081: Albino Pierro 080: Beppe Salvia 079: Ottiero Ottieri 078: Eugenio Montale (3) 077: Antonio Riccardi 076: Amelia Rosselli (2) 075: Nelo Risi 074: David Maria Turoldo 073: Pier Paolo Pasolini (3) 072: Franco Scataglini 071: Patrizia Vicinelli 070: Milo de Angelis (2) 069: Umberto Piersanti 068: Giorgio Orelli 067: Elisa Biagini 066: Remo Pagnanelli (2) 065: Carlo Bettocchi 064: Vittorio Sereni (2) 063: Giorgio Bassani 062: Federico Italiano 061: Gabriele Frasca 060: Andrea Zanzotto (3) 059: Patrizia Cavalli (2) 058: Antonio Porta 057: Vincenzo Frungillo 056: Gianni D'Elia 055: Gregorio Scalise 054: Giorgio Caproni (2) 053: Stefano Dal Bianco 052: Biagio Marin 051: Elsa Morante 050: Franco Buffoni 049: Franco Loi (2) 048: Ferruccio Benzoni 047: Eugenio Montale (2) 046: Adriano Spatola 045: Dario Bellezza 044: Tonino Guerra 043: Luciano Erba 042: Jolanda Insana 041: Mario Luzi 040: Primo Levi 039: Valerio Magrelli (2) 038: Paolo Volponi 037: Alda Merini 036: Pier Paolo Pasolini (2) 035: Patrizia Valduga 034: Aldo Nove 033: Raffaello Baldini 032: Maurizio Cucchi 031: Piero Bigongiari 030: Andrea Zanzotto (2) 029: Gerhard Kofler 028: Remo Pagnanelli 027: Andrea Gibellini 026: Fabio Pusterla 025: Michele Sovente 024: Anna Maria Carpi 023: Gian Mario Villalta 022: Edoardo Sanguineti 021: Roberto Roversi 020: Patrizia Cavalli 019: Giuseppe Conte 018: Giovanni Giudici 017: Valerio Magrelli 016: Giorgio Caproni 015: Andrea Zanzotto 014: Attilio Bertolucci 013: Emilio Villa 012: Giampiero Neri 011: Giovanni Raboni 010: Amelia Rosselli 009: Sandro Penna 008: Antonella Anedda 007: Pier Paolo Pasolini 006: Fernando Bandini 005: Milo de Angelis 004: Vittorio Sereni 003: Franco Fortini 002: Franco Loi 001: Eugenio Montale satt.org-Links: Latin.Log Gedichte aus Lateinamerika (2005-2008). Herausgegeben von Timo Berger und Rike Bolte. Lyrik.Log Die Gedichtanthologie (2003-2005). Herausgegeben von Ron Winkler. |
|
Vittorio Sereni, 1913 in Luino (Lombardei) geboren, Literatur- und Philosophiestudium in Mailand. 1938 gehörte Sereni zu den Mitbegründern der Zeitschrift „Corrente“ und war Mitarbeiter von „Campo di Marte" und „Frontespizio“. 1941 erschien sein erster Gedichtband, Frontiera. Im zweiten Weltkrieg einberufen, wird er zunächst nach Griechenland, dann nach Sizilien geschickt. 1943 gerät er in Kriegsgefangenschaft und verbringt zwei Jahre in Gefangenenlagern in Algerien und Marokko. Diese Erfahrung geht direkt in sein zweites, Gedichte und Prosa verschränkendes Buch, Diario d’Algeria ein. Nach dem Krieg unterrichtete er und schrieb als Literaturkritiker für „Milano Sera“. 1965 publizierte er Gli strumenti umani, 1981 kommt bei Einaudi der Band Il musicante di Saint-Merry heraus, mit Übersetzungen von Pound, Char, Williams, Frénaud, Apollinaire, Camus, Corneille u.a. Im selben Jahr erscheint außerdem Stella variabile, mit dem Claudio Sereni im Folgejahr den Premio Viareggio gewinnt. Am 10. Februar 1983 stirbt Sereni in seiner Wahlheimat Mailand. |
Andrea Zanzotto über Stella variabile:
Dichtung, gemacht aus Worten, die Instrumente des Alltäglichen und gleichzeitig Konkretion von soziohistorischen Spuren sind – bewegt sich in erster Linie „innerhalb“ einer bestimmten Sprache, ja mehr noch, sie ist deren wahre idiomatische Seele. Sie verweist nicht bloß auf die extreme Besonderheit „jener“ Sprache, die etymologisch gesehen als Idiom einer einzigen ethnischen Gruppe angehört. Vielmehr drückt sie (geradezu vorbildlich) deren Besonderheit aus, das ìdion, das berufen ist, als Einzigartigkeit in der Dichtung zu erscheinen und somit „erwählt“, „auserkoren“ zu werden. Die Sprache trägt die unendliche und notwendige Selbstliebkosung und die narzißtische Einschneckung der (ethnischen und nicht nur ethnischen) Gruppe in sich: das, was dann als Barriere wiederkommt, als Unmöglichkeit der rückstandslosen Übersetzung. Diese narzißtische Selbstliebkosung, die schon in der Vorstellung von idìoma verankert ist, führt – wiederum zwangsläufig – dazu, sich in der Sprache, in jeder Sprache, einerseits Paradiese autistischer Art vorzustellen, andererseits (letztlich umkehrbare) edenische oder pfingstliche Halluzinationen, die beide gleichermaßen entfernt sind von der tatsächlichen Brutalität „dieser“ Sprache, die unüberwindliches, unverrückbares Ereignis/Konvention ist, in die jeder Ausdruck in jeder „historischen“ Sprache einbricht, und um wie viel mehr noch die Form des Ausdrucks, die man Dichtung nennt. Der Versuch poetischer Erfahrung ist folglich mit einem „Risiko Sprache“ verbunden, worin nicht nur die Notwendigkeit gegenwärtig ist, die „Frequenzen“, die innersten „Berufungen“ dieser Sprache, die ihr innewohnenden Strömungen und Wirbel zu fühlen, sondern auch das Bewußtsein, daß alle diese Kräfte in ebendem Akt, in dem sie sich zur Sprache fügen, sie „verschließen“ und innerhalb des babelischen Schemas zum Feld des Ausschlusses, der Fragmentierung machen. Darum lebt in jedem Dichter die Sehnsucht nach einer Sprache fort, die universal sein soll und nicht „idiomatisch“, auch wenn sie trotzdem noch „muttersprachlich-eigen“ ist.
In diesem Spannungsfeld ist es der Dichtung beschieden, sich zwar als bloßer Signifikant darzustellen, der ein gewaltiges Spiel von Signifikanten stützt, aber im Gegenzug unbeherrschbare, unendliche Sehnsüchte nach Signifikaten ans Licht bringt, wie ein flatus vocis, innerhalb dessen sich ein dermaßen weites Sinnfeld auftut, daß es im Freudschen Sinn „unheimlich“ wird. Einer, der ausgehend von der Idee des Heimlichen, Häuslichen, des Zuhause-, im eigenen Gehäuse-Bleibens „Dichtung“ sagt, der hat die 273 Grad unter Null des kosmischen Raums im Nacken, der absoluten Fremdheit. Das rührt auch daher, daß er alles, was einen, vor allem sprachlichen Mikrokosmos ausmacht, zu unmöglichen Funktionen des Makrokosmos getrieben hat: doch anders konnte es sich nicht zutragen. An diesem Punkt wird es noch schwieriger, zum Problem eines Wissens um die Entstehung von Dichtung zurückzukehren, zur Dichtung als Versuch und Erfahrung, die zu einem Text, einem Gegenstand geführt haben. Was die Autoren betrifft, die sich in „jenem“ Augenblick „damit beholfen haben“ „jenen“ Text zu schreiben, so liefern sie die vollkommen aufgetrennte Serie von Indizien, von „Blitz-Poetiken“: aber vielleicht verweist jeder einzelne Punkt des Gedichts auf diese oder ist aus ihnen gebildet. Der Dichter wird Indizien zum „Idiom“ seines Schaffens geben, während er zugleich das von ihm gebrauchte historische Idiom bis an die Grenze seiner Idiomatizität/Besonderheit treibt. Vittorio Sereni wußte in Gli immediati dintorni grundsätzliche Dinge dazu zu sagen und er hat schließlich für sein letztes Werk einen der hellsichtigsten Titel gefunden, den man, wie ich meine, einem Gedichtband geben kann: Stella variabile – Wandelbarer Stern. Der Ausdruck verbindet ihn in gewisser Weise mit René Char, in der von Stefano Agosti oft betonten Weise. Und wir wissen um den Gegensatz und die fruchtbaren Affinitäten, die zwischen Char und Sereni bestanden.
Eine ganze Poetik mit all ihren Regeln ist in diesem Syntagma Stella variabile ausgedrückt. Der wandelbare Stern ist eine hohe Metapher, die das beständige Schwanken der nicht festgelegten Poetiken der Dichter bezeichnet. Und es wäre interessant, vor diesem Hintergrund die verschiedenen Kategorien von wandelbaren Sternen zu untersuchen; vielleicht würde daraus eine ganze Phänomenologie der nach bestimmten Sterntypen katalogisierbaren Dichtung entspringen ... und zwar ausgehend von jenen Sternen, die in Wirklichkeit aus zwei Himmelskörpern bestehen, von denen der eine den anderen (wie bei einer Sonnenfinsternis) auslöscht, bis hin zu jenen, die pulsieren, mit einer gewissen Regelmäßigkeit von einem Leuchtgrad zum anderen übergehen, bis hin zu jenen, die dazu beitragen können, die anderen, nicht wandelbaren Sterne besser kennenzulernen, und letztlich bis zu jenen, die zur Kategorie der Novas und Supernovas gehören, die Explosion sind, „Kurzschluß“ par excellence, und so weiter.
Die Dichtung kann also wie ein Fixpunkt „pulsierender“ Stabilität erscheinen, stabil, indem sie eine poetische Logik (gebunden an jede Form von Logik) einschließt, aber doch „unzuverlässig“ im beständigen Wechsel ihrer Leuchtkraft. Unzuverlässig als Erkenntnistatsache, die außerhalb der Dichtung angesiedelt ist, oder besser außerhalb des Werks des einzelnen Autors, und die keinerlei Gesetz für keinerlei Erfindung erkennen läßt, das sich nicht letztlich mit dem „gerade stattfindenden Text“ vermischt. Hier kehrt das alte Diktum wieder, demzufolge die Dichtung immer von sich selbst spricht, auch wenn sie glaubt, von anderem zu sprechen – trotzdem kann sie nur existieren, um sich auszusprechen, indem sie zum anderen und von anderem, von allem spricht. („Tentativi di esperienza poetica (Poetiche-lampo)“, in: Prospezioni e consuntivi, 1999, Übersetzung: T. P.)
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

