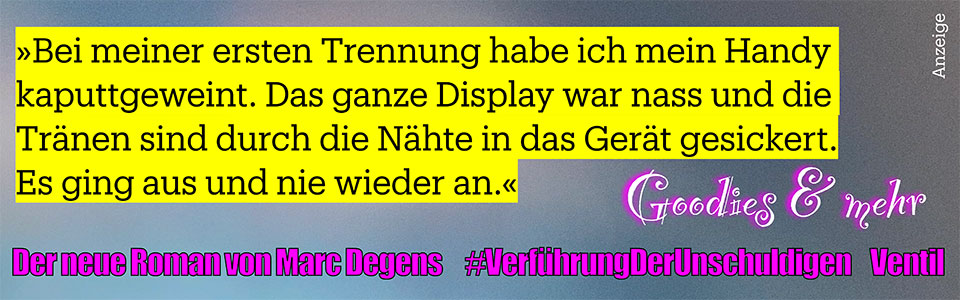Der Titel dieser kurzen Einführung ist zugleich Programm: In zumindest 99 exemplarischen Folgen eine zurückschauend-kontinuierliche, punktuell-registrierende, systematisch-vertiefende Panoramaansicht der zeitgenössischen italienischen Poesielandschaft der letzten Jahrzehnte zu geben, mit dem Ideal, literarische Ahnenforschung und Darstellung der Vitalität einer „Szene“ produktiv miteinander zu verknüpfen. Nicht zuletzt aufgrund der beträchtlichen, im Grunde unbegreiflichen Rezeptionslücken in Bezug auf die italienische Lyrik des 20. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum, haben wir uns dabei für eine „Öffnung“ der Gegenwart auf den Zeitraum nach 1968 entschieden. Zu diesem, nicht nur poetisch bewegten historischen Augenblick, ist die Generation der „Großen Alten“ und ihrer jüngeren Geschwister noch aktiv: Eugenio Montale, Carlo Betocchi, Sandro Penna, Attilio Bertolucci, Giorgio Caproni, Vittorio Sereni, Mario Luzi, Franco Fortini, Pier Paolo Pasolini, Andrea Zanzotto oder Giovanni Giudici schreiben in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts einige ihrer interessantesten Gedichtbände, in einem Klima, das lebendiger und mannigfaltiger nicht sein könnte. 1968 erscheint Andrea Zanzottos maßstabsetzender Zyklus La Beltà, wenige Jahre darauf, 1971, weitere wichtige Bücher: Pier Paolo Pasolinis später und heterogener Band Trasumanar e organizzar; Satura, das innovative, innerhalb des Gesamtwerks einen Bruch markierende vierte Versbuch Eugenio Montales (der wohl zentralsten und komplexesten poetischen Erscheinung des italienischen 20. Jahrhunderts); Attilio Bertoluccis Viaggio d’inverno sowie, von Pasolini enthusiastisch begrüßt, Invettive e licenze von Dario Bellezza. Figuren wie Amelia Rosselli, Antonio Porta, Fernando Bandini, Edoardo Sanguineti oder Giovanni Raboni, alle in den 30-er Jahren geboren, stehen Mitte der 70-er Jahre am Höhepunkt ihres Schaffens, während eine neue Generation erst die Szene betritt: mit zum Teil beachtlichen Ergebnissen und vor dem Horizont einer geradezu explosiv ansteigenden Poesieproduktion. (Das Gedicht wird zum Massenphänomen, von „trasandatezza stilistica“, einem Trend zu stilistischer Nachlässigkeit oder Schlampigkeit spricht in diesem Kontext der Kritiker Alfonso Berardinelli). Einige der damals herausragenden Namen (Milo de Angelis, Patrizia Cavalli, Maurizio Cucchi u.a.) prägen bis heute das Bild der italienischen Poesielandschaft, neben Autorinnen und Autoren der nachrückenden Generation wie Valerio Magrelli, Gianni D’Elia, Fabio Pusterla oder Antonella Anedda.
In dem von uns ins Auge gefaßten Zeitabschnitt scheint sich das „kurze 20. Jahrhundert“ (il secolo breve, wie es in Italien beinahe sprichwörtlich heißt) ganz ungemein zu beschleunigen: Gruppierungen formieren sich und tauchen wieder ab, Entwürfe werden formuliert und halten ihrer Verwirklichung nur eine kurze Weile stand; und fast alle der oben zitierten Bücher sind im Wesentlichen bereits vor dem Hintergrund der Krise der Avantgarden entstanden, um von dort aus noch einmal prinzipiell zu einer, zumeist sehr persönlich getönten Hinterfragung der Ausdrucksmodalitäten anzusetzen. Eine Zeit des stilistischen Eklektizismus, außergewöhnlich fruchtbar und vielfältig, doch auch widersprüchlich und unstet, wo überbordend-narrative Tendenzen neben neo-metrischen Bestrebungen, Resultate einer sprachkritisch-emphatischen und im besten Sinne „europäisch“ orientierten Moderne (wie etwa bei Andrea Zanzotto, der in seinen Anfängen noch stark dem italienischen Hermetismus verhaftet war) neben diffusen Aufbruchs- oder Abschiedsgesten gleichermaßen Platz finden. Aber Abschied wovon? Auch für die Poesie Italiens scheint sich wieder und wieder zu bewahrheiten, was Giuseppe Tomasi di Lampedusa seinem Protagonisten Tancredi in den Mund legte: daß alles sich verändern muß, um so zu bleiben, wie es ist... In diesem Forum sollten beide, die Umstürzler und die Umgestürzten, sporadisch flankiert von ihren Kritikern, Liebhabern und Apologeten, abwechselnd zu Wort kommen; in einer zwar weit ausholenden, doch um Fixierung bemühten, zwangsläufig selektiven Sondierungsbewegung.
„italo.log“ – die hier angezettelte Online-Anthologie für eine zeitgenössische, nach vorne und zugleich zurückblickende, mobile Archivierung jüngerer italienischer Dichtungsgeschichte folgt einerseits dem Impuls, bei zu Unrecht aus dem „Kanon“ des vergangenen Jahrhunderts gerutschten oder im deutschen Sprachraum gar nicht erst angekommenen Stimmen ein wenig länger zu verweilen, andererseits jenem, bei neueren und neusten Stimmen auch Resonanzen nachzulauschen und also sprunghaft zurückzuschalten, um ein Echo, einen Anklang, eine Verwandtschaft vernehmbar zu machen. Zurückspulen – Vorspulen, Zurückspulen – Vorspulen: zuhören, anhalten, einrasten. Vom Gedicht als „momentary stay against confusion“, spricht Roberto Frost: jedes Fenster des „italo.log“ könnte, für an heutiger italienischer Dichtung Interessierte, eine solche Halte-Stelle, eine solche Inne-Haltestelle sein.
Oder anders, und umgekehrt: „Nur wer die Straße geht, erfährt von ihrer Herrschaft“ (Walter Benjamin, Einbahnstraße). Das gilt auch für die vielleicht unscheinbarste aller gängigen Vergänglichkeitserfahrungen: das lange Fußwege nicht scheuende, tastende und antastende, vorgegebenen Fährten vorsichtig nachgehende Übersetzen – auf dem ein Projekt wie dieses stillschweigend beruht.
» Weiter zum ersten italo.log: Eugenio Montale
Roberto Galaverni, geboren 1964 in Modena, lebt in Bologna. Literaturkritiker, Essayist, Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten (Master di poesia contemporanea der Universität von Urbino). Veröffentlichungen in Zeitschriften und Feuilletons, mit Schwerpunkt Poesie. Mitarbeiter von „Nuovi Argomenti“, „Alias – il Manifesto“ sowie der Programme von Radio3 Rai. Lehrtätigkeit an der Universität Bologna, Gründungsmitglied und ständiger Berater des „Centro di poesia contemporanea“. 2000 Visiting Professor an der Oxford University und am London College. Buchveröffentlichungen: Nuovi poeti italiani contemporanei (Anthologie neuerer italienischer DichterInnen, Rimini, Guaraldi, 1996). 2001 I luoghi dei poeti (Bari, Palomar), 2002 der Band Dopo la poesia. Saggi sui contemporanei (Roma, Fazi Editore). 2006, wieder bei Fazi, das Pamphlet Il poeta è un cavaliere Jedi. Una difesa della poesia.
Theresia Prammer, geboren 1973, lebt in Berlin und Wien. Aufsätze und Artikel zur italienischen Poesie der Gegenwart und zur literarischen Übersetzung. Herausgaben, Essays, Gedichtübersetzungen aus dem Italienischen und Französischen (Ghérasim Luca, Eugenio Montale, Amelia Rosselli, Andrea Zanzotto) ins Deutsche und ins Italienische (Elke Erb, Steffen Popp, Ann Cotten u.a.). 1999 Übersetzerpreis der Stadt Wien, 2001 Stipendiatin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 2005 „Lesarten der Sprache. Andrea Zanzotto in deutschen Übersetzungen“ (Würzburg, K&N). 2007 Dissertation zu Grenzformen der Poesieübersetzung („Übersetzen. Überschreiben. Einverleiben. Verlaufsformen poetischer Rede“, Dis., Uni-Wien).