
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
22. November 2018 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||||
|
|
|
 |
Cold War -
Der Breitengrad
der Liebe
(Pawel Pawlikowski)
Originaltitel: Zimna wojna, Polen / Großbritannien / Frankreich 2018, Buch: Pawel Pawlikowski, Janusz Glowacki, in Zusammenarbeit mit Piotr Borkowski, Kamera: Lukasz Zal, Schnitt: Jaroslaw Kaminski, Jazz und Song-Arrangements: Marcin Masecki, Kostüme: Aleksandra Staszko, Szenenbild: Katarzyna Sobanska, Marcel Slawinski, mit Joanna Kulig (Zula), Tomasz Kot (Wiktor), Borys Szyc (Kaczmarek), Agata Kulesza (Irena), Cédric Kahn (Michel), Jeanne Balibar (Juliette), 89 Min., Kinostart: 22. November 2018
Nach seinem letzten, oscar-prämierten Film Ida wollte sich Pawel Pawlikowski eigentlich nicht visuell wiederholen, doch er stellte schnell fest, dass das Polen der 1950er für ihn in Farbe einfach nicht funktionierte. Und so ist auch Zimna wojna in Schwarzweiß gehalten, inklusive des fast quadratischen Academy-Formats (4:3), das er ebenfalls schon in Ida nutzte (und zumindest ähnlich in seinen frühen Dokumentarfilmen).
Wie der deutsche Zusatztitel »Der Breitengrad der Liebe« überdeutlich betont, geht es um eine Liebensgeschichte inmitten der politischen Wirren von 1949 bis 1964. Passend zum »Breitengrad« beginnend in Polen, aber im Verlauf der Jahre über Jugoslawien bis nach Berlin und Paris (wer neugierig ist, schaut nach den kleinen Gaststars in den Credits) ausgeweitet.
Der begabte Komponist Wiktor (Tomasz Kot, für Bogowie Gewinner des Polnischen Filmpreises als bester Hauptdarsteller) trifft auf die energiegeladene junge Sängerin Zula (Joanna Kulig, nach u.a. Ida schon zum dritten Mal in einem Pawilikowski-Film), die beiden finden zueinander, werden aber immer wieder auseinandergerissen (»Hast Du jemanden?« [...] »Ja, ich auch.«), nicht zuletzt auch wegen unterschiedlicher Prioritäten, was die politischen Überzeugungen und die musikalische Karriere angeht.
Es ist offensichtlich, dass es sich um eine Herzensangelegenheit für den Regisseur handelte (nicht zuletzt verwendete er für seine Hauptfiguren die Vornamen seiner Eltern), aber die tiefempfundene Liebe, die sich über viele Jahre erstreckt, wirkte auf mich etwas »behauptet«, nicht in ausreichendem Maße über die Inszenierung vermittelt (wie in vergleichbaren Langzeit-On/Off-Beziehungsfilmen wie When Harry Met Sally oder Les parapluies de Cherbourg).
Neben der love story geht es aber noch um andere Themen wie die musikalischen Karrieren, die teilweise wie Papierschiffchen im Sturm der politischen Mächte umhergeworfen werden. Nur erreicht die Thematik ohne die »Liebes«-Unterfütterung nicht ganz die vermutlich angestrebte empathische Einbindung des Zuschauers.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass einige Kinogänger von der Geschichte von Zula und Wiktor mitgerissen werden, sich an eigene Erfahrungen erinnern undsoweiter, aber für mich und den Kreis meiner liebsten (KollegInnen) fiel Cold War vergleichsweise ... wie sag ich's nett? ... »langatmig« aus.
Der Film hat verschiedene Anknüpfungspunkte für das Publikum (Liebe, Musik, Politik, visuelle Umsetzung), sie funktionieren nur unterschiedlich gut und unterstützen sich nur bedingt gegenseitig.
Pawlikowski nutzt seine elliptische Erzählweise laut eigenen Angaben, um dem Publikum die Möglichkeit zu geben, die »Lücken« selbst zu ergänzen. Ich mag mich irren, aber das scheint auch nur für einen eher kleinen Prozentsatz der Zuschauer zu funktionieren. Vielleicht vor allem solche, die den beschriebenen Zeitraum in den Spielorten selbst erlebt haben.
Mich überzeugte der Film eher in Einzelabschnitten, vor allem gegen Beginn (irgendwann klinkte ich mich ein wenig aus). Der Castingprozess, über den Zula und Wiktor sich kennenlernen, war interessant (irgendwo zwischen Fame und DSDS, nur in Folklore-Trachten), dann Zulas lapidare Beschreibung eines Problems mit ihrem Vater (»Er verwechselte mich mit meiner Mutter und ich zeigte ihm den Unterschied mit einem Messer«) und die zunehmende Umgewichtung der zunächst sehr traditionsbewussten musikalischen Darbietungen hin zu kaum kaschierten Propaganda-Veranstaltungen. Meinen ganz persönlichen Interessengebieten entsprach dann Wiktors Arbeit am Soundtrack eines italienischen Gruselfilms, etwas später holpert Zula sich durch französische Chansons, was auch einen gewissen Reiz hat. Aber das hält mich immer nur zwischendurch für drei oder vier Minuten »bei der Stange«, für einen recht kompakten 89-Minuten-Film ist die »gefühlte« Länge schon gehörig.
Schade, denn Pawlikowskis frühere Filme My Summer of Love, Last Resort und Ida haben mir alle viel besser gefallen (ich kenne nicht alle seine Werke). Er wirkt hier fast ein bisschen zu sehr von seinen eigenen Fähigkeiten überzeugt, was dazu führen kann, dass man seine Arbeit zu wenig hinterfragt.
Nachtrag: Zimna wojna hat die meisten Nominierungen für die Europäischen Filmpreise 2018 erhalten. Der Film wurde in fünf Kategorien nominiert - als Bester Film, Pawel Pawlikowski für die Beste Regie und für das Beste Drehbuch, Joanna Kulig als Beste Darstellerin und Tomasz Kot als Bester Darsteller. An der Bewertung hier ändert dies natürlich nicht das Geringste.
 |
Future World
(James Franco &
Bruce Thierry Cheung)
USA 2018, Buch: Jeremy Cheung, Jay Davis, Bruce Thierry Cheung, Kamera: Peter Zeitlinger, Schnitt: Alex Freitas, William Paley, Musik: Toydrum, Kostüme: David Page, Production Design: Eve McCarney, Art Direction: Patrick Jackson, Set Decoration: Sandra Skora, mit Suki Waterhouse (Ash), James Franco (Warlord), Jeffrey Wahlberg (Prince), Margarita Levieva (Lei), Rumer Willis (Rosie), Lucy Liu (Queen), Milla Jovovich (Drug Lord), Snoop Dogg (Love Lord), George Lewis Jr. (Ratcatcher), Clifford »Method Man« Smith (Tattooed Face), Carmen Argenziano (Grandfather), Elisha Henig (Grandson), Craig Kline (Old Traveler), Tamzin Brown (Sweet Tea), 90 Min., DVD-Release: 8. November 2018
Hierzulande bekommt man nur im Ansatz mit, wie vielbeschäftigt James Franco als Regisseur fungiert. Zwei bis vier Regiearbeiten im Jahr knattert er runter wie seinerzeit nur Takashi Miike, darunter Faulkner-Adaptionen und vergleichbares, was nur ein ganz spezielles Publikum anspricht - aber auch einem trashigen Sci-Fi-Action-Spektakel im Gefolge von Mad Max ist er nicht abgeneigt. Und in diesem Fall bekommt man über Fantasy Filmfest und DVD-Start auch die Möglichkeit, ohne Internet-Kriminalität am Output Francos teilzuhaben.
Diesen Film runterzumachen ist ein einfaches, denn trotz hochkarätigen Darstellern und vielen gestalterischen Ideen sieht man dem Streifen zu jedem Zeitpunkt an, wie schnell er heruntergekurbelt wurde und wo man an dem Drehbuch vielleicht noch etwas hätte feilen sollen. Aber hin und wieder kann man ja auch mal die positiven Aspekte loben, selbst wenn man den Film kaum mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann.
Ich fand zum Beispiel interessant, wie Franco und sein Co-Regisseur (der im Gegensatz zu Franco zusammen mit seinem Bruder am Drehbuch beteiligt war und womöglich über den bekannten Namen Finanzierung und Publikumsinteresse generieren wollte) komplexe lange Kameraeinstellungen einsetzt, um der epischen Größe der Endzeit-Kulissen die Möglichkeit zu geben, Eindruck zu schinden (seit Joss Whedons Firefly und Dollhouse eine öfters mal genutzte Strategie). Man merkt in diesen Szenen zwar, dass es wichtiger war, die Choreographie der Motorräder abzustimmen als Feinheiten im Schauspiel, aber wenn man hier und da das Talent der Filmemacher aufblitzen sieht, hilft einem dies über viele klischeehafte Action-Momente und dutzendfach gesehene Story-Entwicklungen hinweg.
Alles in allem hat Future World auch einige Story-Überraschungen in petto, was ebenfalls klar auf der Habenseite zu verbuchen ist. Einiges davon verstärkt zwar den Eindruck, dass man ganz gezielt einem angenommenen Publikumsgeschmack hinterherhechelt (ist es ein Zufall, dass Hauptdarstellerin Suki Waterhouse auch in Assassination Nation mitspielt?), aber hier funktioniert zumindest der feministische Ansatz halbwegs (auch, wenn man zu offensichtlich die Standard-Knöpfe drückt und den Frauenfiguren über die generelle Messitsch nicht wirklich Raum gibt, sich zu entwickeln).
Dass eine gutaussehende »Roboterin« (Waterhouse) wie Germany's Next Top Model durch den Wüstensand stakst und tiefschürfende Fragen über die Liebe und das Konzept Seele stellt, während barbarische Kerle und Milla Jovovich als ganz amüsante Vorzeige-Schurkin daran feilen, die ohnehin spärliche Erdbevölkerung zu dezimieren, ist nur eingeschränkt abendfüllend, und wenn man diese Mischung aus Blade Runner, Mad Max, Escape from New York und Michel aus Lönneberga (ich weiß nicht mehr, warum ich mir das letzte Werk aufgeschrieben habe, aber ich vertraue meinen Notizen) dann noch mit vagen mythologischen Stammestraditionen unterfüttert, bevor Snoop Dogg als Ober-Pimp seine unterjochten Sexarbeiterinnen zur Revolution treibt, fehlen auch die unfreiwillig komischen Momente nicht. Wirklich ernstnehmen kann man das Filmchen aber bei aller Altersmilde zu keinem Zeitpunkt.
 |
Rememory
(Mark Palansky)
Kanada 2017, Buch: Michael Vukadinovich, Mark Palansky, Kamera: Greg Middleton, Schnitt: Tyler Nelson, Jane Macrae, Musik: Gregory Tripi, Kostüme: Patricia L. Hargreaves, Production Design: Hank Mann, mit Peter Dinklage (Samuel Bloom), Julia Ormond (Carolyn Dunn), Martin Donovan (Gordon Dunn), Evelyne Brochu (Wendy), Anton Yelchin (Todd), Jordana Largy (Freddie the Bartender), Henry Ian Cusick (Robert Lawton), Sarah Jane Redmond (Allison), Länge laut Presseheft 1:51 Minuten [Ich denk' mir die Scheiße nicht aus!], Kinostart: 8. November 2018
Mark Palansky hat mal vor zehn Jahren bei der eigentümlichen RomCom Penelope mit Cristina Ricci Regie geführt. Den Namen der schweinsnasigen Hauptfigur assoziiere ich immer mit der Wortkombination »pen« (engl. für Schweinestall) und »elope« (flüchten / durchbrennen), wodurch der Film noch eine Spur stylischer wird ;-)
Seine zweite Regiearbeit Rememory klingt zwar zunächst sehr vielversprechend, nach Detektivgeschichte mit Thriller-Elementen und einem Hauch SciFi - doch der Film kann diese Versprechen nicht einhalten.
Wissenschaftler Gordon Dunn (Martin Donovan) hat ein Gerät entwickelt, mit dem man Erinnerungen aufzeichnen kann - wird aber kurz nach seiner großen Vorstellung des Projekts tot aufgefunden. Der eigentümliche, oft unter falschem Namen recherchierende Samuel Bloom (Peter Dinklage) macht sich daran, die Hintergründe des Todesfalls zu erkunden. Sam selbst hat aber - wie so ziemlich jede wichtige Figur im Film - ein Erinnerungstrauma zu bewältigen, das sich mit den detektivischen Bemühungen (er heißt Sam wie Spade, sein Bruder Dash wie Dashiell Hammett - da waren wohl schon die Eltern Krimi-Fans) verflechtet - zumindest hat man den Eindruck, dass dies die Herangehensweise an die Geschichte war, die sich aber nicht wirklich entwickelt: die Ermittlungen bringen wenig, kriechen von einer Person zur nächsten, während es jedem Zuschauer überdeutlich klar ist, dass Sam vor allem seine persönlichen Probleme bewältigen muss.
Dabei hat die Figur des Sam auch noch das Problem, dass man ihn auch losgelöst von seinem mühsam erarbeiteten Familienschicksal nicht wirklich ernst nehmen kann. Ein Kleinwüchsiger, der sich mit Miniaturen beschäftigt - das mag auf den Seiten eines Drehbuchs noch ganz clever wirken, funktioniert hier aber so gar nicht. Passend zur schleichenden Entwicklung der zwei Fälle bastelt Sam an einer Miniatur-Reinszenierung seiner verdrängten Erinnerungen, die so visualisiert werden.
Auch die Erinnerungen an sich (mehrere Personen, größtenteils in den Todesfall verwickelt, haben ihre aufgezeichnet) enttäuschen, wirken wie ganz auf die Story zugeschnitten, Werbeästhetik mit einem Schuss Futurismus und dazu passendes Musikgedudel. Und wenn dann irgendwann der Kniff der Story ausgeknobelt wird, ist auch das eine Enttäuschung.
Kleines Detail am Rande, das ich auch suspekt fand: Peter Dinklage wird im Film durchweg inszeniert, als wäre er normalgroß. Wenn er im Theater sitzt, ist er so groß wie alle anderen, wenn er nach Jahren auf seinen Bruder trifft und in dessen Auto einsteigt, kann er offenbar ohne Hilfsmittel alle Pedale erreichen. Das ist natürlich wieder die Vorwerk'sche Erbsenzählerei, aber ich frage mich: wenn man schon einen so außergewöhnlichen Schauspieler verpflichtet, wäre es da nicht angemessen, seine persönliche Situation irgendwie beim Erstellen seiner Filmfigur zu reflektieren? Ich denke schon.
Ach ja, und wer mit dem Gedanken spielt, sich den Film anzuschauern, weil er (mal wieder) als der (jetzt aber wirklich) letzte Film mit Anton Yelchin angepriesen wird: Yelchins Rolle ist nicht komplett uninteressant, fordert aber schon eine Menge Overacting dafür, dass sie nur in etwa drei, eher kurzen Szenen eine Rolle spielt.
Ausnahmsweise:
Drei abgebrochene Filme aus dem November
Wenn man Pressevorführungen nicht zuende schaut, macht man sich bei den betreuenden Agenturen nicht unbedingt beliebt. Wenn man dann auch noch trotzdem Texte zu den Bruchstück-Einblicken veröffentlicht, verzückt man auch nicht unbedingt die Leser, aber wenn sich die Filme für mich als unerträglich erweisen, habe ich nicht unbedingt diese masochistische Ader, um sie bis zum Schluss durchzuziehen. Irgendein Kritikerkollege verteufelte jüngst das nicht-zu-Ende-Schauen von Filmen, weil man dann ja nie weiß, wie es zuende gegangen wäre. Damit habe ich nicht das geringste Problem...
Es mag anmaßend sein, sich zu erdreisten, über halbgesichtete Filme ein Urteil zu fällen, aber ich habe großes Vertrauen in meine Entscheidungen und will die aus Selbstverteidigung abgebrochenen Filme eigentlich auch nie später »nachholen«. Inwieweit meine Meinung die LeserInnen davon abhält, sich für diese Filme zu entscheiden, muss allerdings jedeR für sich selbst entscheiden.
 |
Der Nussknacker
und die vier Reiche
(Lasse Hallström
& Joe Johnston)
Originaltitel: The Nutcracker and the Four Realms, USA 2018, Buch: Ashleigh Powell, Lit. Vorlage: E.T.A. Hoffmann, Marius Petipa [Ballett], Kamera: Linus Sandgren, Schnitt: Stuart Levy, Musik: James Newton Howard, Kostüme: Jenny Beavan, Production Design: Guy Hendrix Dyas, Supervising Art Director: Stuart Kearns, mit Mackenzie Foy (Clara Stahlbaum), Matthew Macfadyen (Benjamin Stahlbaum), Thomas Sweet (Fritz Stahlbaum), Ellie Bamber (Louise Stahlbaum), Morgan Freeman (Drosselmeyer), Jayden Fowora-Knight (Philip Hoffman), [nach meinem Verlassen des Kinos sollen noch Keira Knightley, Helen Mirren, Richard E. Grant und diverse andere im Film aufgetaucht sein], 100 Min., Kinostart: 1. November 2018
Vorführung nach gefühlt 30 Minuten verlassen
(Kolleg*innen, die in meiner Sitzreihe saßen, schätzten meinen Abbruch auf nach zehn bzw. 15 Minuten)
Das Licht geht aus, der Vorhang öffnet sich, auf der Leinwand sieht man eine Wüstenlandschaft, auf der Spitze einer Düne traben hintereinander vier berittene Kamele, ein Vogel (offensichtlich CGI) segelt in Höhe der Kamera ins Bild.
Das war erst mal eine positive, weil komplett unerwartete Überraschung, aber wenige Sekunden später begreife ich über die mir vertraute Musik (nicht Tschaikowsky, sondern Alan Menken), dass man dem Film noch einen Teaser für eine Realverfilmung des Disney-Zeichentrickklassikers Aladdin und einen Trailer für das Sequel Mary Poppins returns (Regie: Rob Marshall, somit für mich komplett indiskutabel) vorgesetzt hat.
Warum ich dies einem Text voransetze, der einem nur teilweise gesehenen Film ohnehin nicht gerecht werden kann? Weil die kurze Trailershow sehr gut verdeutlicht, was beim Disney-Konzern in den letzten Jahren immer deutlicher schief läuft: Man reaktiviert und variiert alles, was man im reichen Archiv früherer Werke (ob selbst herausgebracht oder akquiriert) vor sich hin stauben hat. Wenn die Technologie es möglich macht, muss man dann jeden Zeichentrickklassiker über eine »Real«-Verfilmung erneut auf den Markt schmeißen (wer das Original nicht kennt, sorgt vielleicht für zusätzliche Einnahmen), zu allem ein Remake, Sequel, Prequel oder Spin-Off fabrizieren, damit die Gelddruckmaschine fleißig weiterläuft?
In diesem Jahr deuteten Film wie Christopher Robin und Solo: A Star Wars Story bereits daraufhin, dass auch die Überproduktion mit retardierender Phantasie und / oder einer fehlenden Existenzberechtigung der neuen Produkte nicht automatisch vom Publikum abgenickt wird.
Aber verglichen mit The Nutcracker and the Four Realms sind diese Beispiele für Sand im Getriebe noch hochinteressant und in Teilen gelungen.
Schon die erste, ziemlich lange Einstellung verdeutlicht dies. Erneut fliegt die Kamera über eine reichlich künstlich wirkende Landschaft, das weihnachtliche London etwa der viktorianischen Zeitepoche. Als wenn der Zuschauer es sonst nicht kapieren würde, gesellt sich zum fliegenden Auge der Kamera erneut ein Vogel, der vielleicht irgendwann später im Film eine größere Rolle spielen wird, vorerst aber nur dem visuellen Überwältigungsprinzip dient. Dieses komplett aus dem Rechner stammende historische London zeigt eine Winter Wonderworld mit Puderzuckerschnee, ohne überzeugende Rauminszenierung, dafür wie eine Mischung aus einem Coca-Cola-Werbeclip und einem beliebigen Disneyworld oder -land.
»Die beste aller Weihnachtsgeschichten« (Regisseur Joe Johnston laut Presseheft) wolle man angeblich erzählen, doch nicht nur das Plakat-Tryptichon unterstreicht, dass man hier - wie schon bei Sam Raimis Oz: The Great and Wonderful - dem immensen Erfolg von Tim Burtons Alice in Wonderland nacheifert. Und das reichlich platt und uninspiriert.

Abermals bemüht man eine junge Darstellerin (Mackenzie Foy, die ich in Interstellar noch ganz patent fand) als Protagonistin, ganz im Gefolge dessen, was Alan Moore einst Lost Girls nannte. Und falls dies nicht jedermann auf Anhieb klar werden sollte, läuft »Clara« auf dem Weg in eine zauberhafte Fantasiewelt zunächst einem Nager hinterher (fällt aber nicht wie Alice down the rabbit hole), um kurz danach zu bemerken, dass sie augenscheinlich nicht mehr in London sei (womit auch Lost Girl 2 Dorothy Gale als Vorbild abgehakt war). An dieser Stelle verließ ich übrigens das Kino, doch zuvor gab es noch andere Ärgernisse, die den Fluchtinstinkt in mir weckten (immerhin hatte ich mir extra für diesen Film früher Feierabend von meinem Bürojob erbettelt).
Disney, ein Multi-Millionen-Dollar-Konzern (im englischsprachigen Bereich vermutlich längst sogar multi billion), der jahrzehntelang puderzuckergestäubte Familienideale propagierte, so dass das, was man anderswo »konservativ« nannte, im direkten Vergleich eher progressiv erschien, hat in letzter Zeit die Diversität entdeckt. Disney-Prinzessinnen sind nicht mehr automatisch kaukasisch-blaublütig, sondern dürfen dunkelhäutig, mandeläugig, arabisch oder indigen sein - oder, solange man das Mutterschiff nicht darauf festnagelt, sogar implizit lesbisch. Schon in Christopher Robin war das Nacheifern einer allumfassenden credibility wichtiger als historische Akkuratesse, und weil der Nutcracker noch vor den Weltkriegen spielt, wird es hier noch absurder. Die aufgeweckte und positiv gezeichnete schwarze Hausangestellte und den ausgeputzten Soldaten mit dem außergewöhnlichen Namen »Philip Hoffman« (Verweis auf E.T.A. Hoffman) hätte ich noch durchgehen lassen, aber Morgan Freeman, der in meiner Empfindung einst der original Alibi-Schwarze in Robin Hood - Prince of Thieves war (übrigens ein Film, den ich auch ohne den Bryan-Adams-Song als unerträglich eingestuft hätte), spielt hier den Godfather (!) von Hauptfigur Clara, mit Namen »Drosselmeyer«, und ohne die geringste Brechung von der gesamten besseren Gesellschaft voll akzeptiert. Nun mag man sich rausreden, dass dies ein Fantasymärchen ist (Christopher Robin natürlich auch), aber warum dann die Anbindung an reale Orte und Zeiten? Für mich ist das Geschichtsklitterung, insbesondere natürlich, weil man bei Disney ausreichend Rassismus praktizierte, der jetzt mit großen schwelgerischen Gesten unter den Teppich gefegt werden soll - solange man dafür ausreichend etablierte Schauspielstars hervorkramen kann.
Doch diese Kleinigkeiten am Rand waren nicht schuld daran, dass ich diesen Schmarrn nicht ertragen konnte. Vor allem war es die zwanzigmal wiedergekäute, jeder Spontaneität beraubte Geschichte, die Dutzende Weihnachtsmärchen mit großem Effektkino vermischt und mir dieses Sammelsurium hinrotzt, mit dem selben Ausstattungswahn wie bei Burton und Raimi und einer Hauptdarstellerin, die in der Art und Weise, wie man einst die Harry-Potter-Kinderdarsteller verranzte (Regisseur Lasse Hallström flötet im Presseheft über Mackenzie Foy, sie sei »lebendig, technisch brillant und habe unfehlbare Instinkte«), mit in gefühlt jeder zweiten Großaufnahme aufgerissenen Kullerchen offenbar darauf wartet, dass man ihr eine Viertelliter-Karaffe Augentropfen eintrichtert. Und eine ähnliche Grundeinstellung braucht man auch, wenn man sich hierfür in den Kinosessel setzen will. Seinerzeit nannte man das Ludovico-Therapie. Örks!
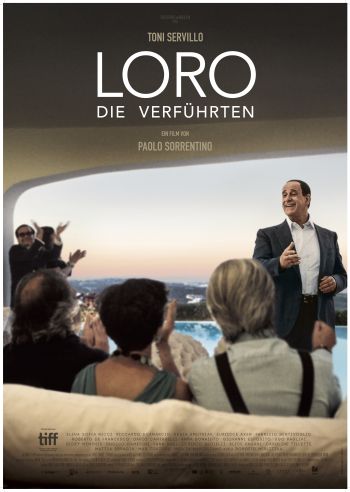 |
Loro - Die Verführten
(Paolo Sorrentino)
Auf Stabangaben verzichte ich diesmal. Sorry!
Vorführung nach gefühlt 30 Minuten verlassen
Zu Filmen, die ich nicht zuende gesehen habe, schreibe ich aus naheliegenden Gründen eher selten Texte, aber in diesem Fall mache ich mal eine Ausnahme. Der neue Sorrentino (Ewige Jugend, La grande bellezza) besteht im Original eigentlich aus zwei Teilen - für Deutschland hat man die etwas verkürzt zusammengeschnitten. Dass der Film sich um Silvio Berlusconi dreht, war selbst bei mir angekommen, passend dazu gibt es zu Beginn mehrere Schrifttafeln, die extra betonen, dass es sich um eine fiktive Geschichte handelt, die reale Inspirationen mit erdachten Figuren kombiniert usw. - glücklicherweise hatte ich das Kino bereits verlassen, bevor der vermutlich nicht »explizit als real gekennzeichnete« Berlusconi-Verschnitt auftauchte, von dessen Begegnung sich eine aufstrebende männliche Figur, die im zweiten Teil des Films kaum mehr aufgetaucht sein soll, sich immens viel erhoffte.
Als »lui«, also »er«, einer Mischung aus diviner Präsenz und italienischem Herrenmagazin, wird Berlusconi nur in Textmitteilungen vage angedeutet, während der Film aber schon exakt so verläuft, wie man es sich in seinem Umfeld vorstellt. Sämtliche halbwegs begüterten Herren hantieren mit Slogans wie »Zeig mir deine Titten!«, es wird geknattert, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt, und das alles mit den selben inszenatorischen Mitteln, die man - so habe ich es zumindest verstanden, vielleicht war das aber auch Wunschdenken - wohl kritisieren will. »Tutti-Frutti-Kino« scheint die naheliegende Umschreibung für diese bodenlos lüsterne Zumutung zu sein, bei selbst noch die wenigen besser gelungenen Ideen einfach nur abschreckend sind.
So etwa die Einstiegsszene, bei der ein Schaf (Symbolismus, ick' hör dir blöken!) eine Luxusvilla betritt, in der auf einem riesigen Flatscreen-Fernseher eine Quizshow läuft. Weil die Tür offensteht, geht automatisch die Klimaanlage an (3¬∞C), inzwischen läuft eine Salami-Werbung, das Schaf macht ähnliche Geräusche wie eine Eiswürfelmaschine und fällt dann tot um. In der nächsten Szene, ohne erkennbaren Zusammenhang, erzählt dann einer dieser Italo-Bonzen von der Hämorrhoiden-Salbe seiner Frau, ehe sich die erste Frau aus dem Bikini schälen soll (»Ich meinte untenrum«), und eigentlich hat man dann auch schon genug gesehen, ich persönlich kann nur soundso viele Mädchenhändler und Kunstturnerinnen mit besonderen Talenten ertragen, wenn sich so überhaupt keine Geschichte daraus entwickelt...
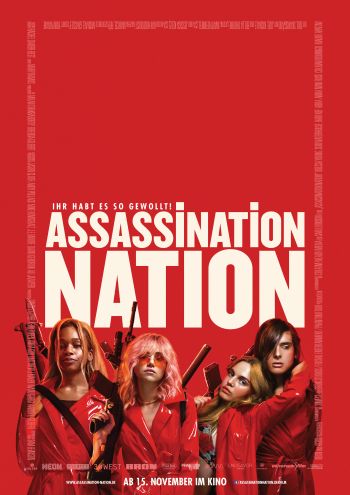 |
Assassination Nation
(Sam Levinson)
USA 2018, Buch: Sam Levinson, Kamera: Marcell Rév, Schnitt: Ron Patane, Musik: Ian Hultquist, Kostüme: Rachel Dainer-Best, Production Design: Michael Grasney, mit Odessa Young (Lily), Hari Nef (Bex), Suki Waterhouse (Sarah), Abra (Em), Colman Domingo (Principal Turrell), Bill Skarsg√•rd (Mark), Joel McHale (Nick), Anika Noni Rose (Nance), Bella Thorne (Reagan), Maude Apatow (Grace), Cody Christian (Johnny), Danny Ramirez (Diamond), Susan Misner (Rose Mathers), Kelvin Harrison Jr. (Mason), Noah Galvin (Marty), 108 Min., Kinostart: 15. November 2018
Vorführung etwa 30 Minuten vor Filmende verlassen
Der Ort heißt Salem, Autor/Regisseur Sam Levinson (Sohn von Barry Levinson, oscarprämiert für Rain Man) scheint also schon mal von Arthur Millers Theaterstück The Crucible / Hexenjagd gehört zu haben (»one of the strangest and most awful chapters in human history«). Die Geschichte spielt nur nicht 1692 und auch nicht während der McCarthy-Ära, sondern in der heutigen Social-Media-Zeit.
Aus der Sicht eines verschworenen Mädchenquartetts, das in seiner toleranten Diversität höchst politisch korrekt, aber nahezu komplett unglaubwürdig erscheint (drei weiße und eine schwarze, wovon eine der weißen recht offensichtlich transgender ist) erlebt man die Aktivitäten eines unbekannten Hackers, der zunächst den örtlichen (und sehr positiv gezeichneten) Schuldirektor (Colman Domingo) über die Veröffentlichung seiner Internetaktivitäten diskreditiert, ehe dann die Anschwärzerei immer größere Kreise zieht.
Der Inszenierungsstil zeichnet sich durch eine Vielzahl von auffälligen Stilmitteln aus (Splitscreen, Zeitlupe, Musikeinsätze, rot eingefärbtes Bild, gefühlt vierzig Triggerwarnungen etc.), der naheliegendste Vergleichsfilms ist Oliver Stones Natural Born Killers, nur ohne den offensichtlichen Grad an Parodie - hier wirkt alles nur besonders möchtegern-jugendlich und -hip, und mehr am Rande geht es um die Verlogenheit der Gesellschaft, denn die ein wenig in die Hauptrolle / Anführerin innerhalb des Quartetts gedrängte Lily (Odessa Young) hat ihr Zeichentalent unter anderem bei nicht komplett züchtigen Skizzen verwandt, was einen (mit dem Internet-Shitstorm verglichen eher kleinen) Sturm der Entrüstung auslöst (»nudity isn't sexual«). Dabei fiel mir bereits negativ auf, dass der Film, um nicht die Freigabe beim jugendlichen Zielpublikum zu riskieren, zwar mal eine gezeichnete Brustwarze aufblitzen lässt, ansonsten aber komplett unangemessen in der Darstellung des jugendlichen Sturm und Drangs rüberkommt. Alles wird immer nur vage angedeutet, nicht zuletzt auch Lilys Beziehung zu einem Herrn, den sie »Daddy« nennt. Dieses permanente Schocken mit »angezogener Handbremse« ist für manche Zuschauer sehr anstrengend und ärgerlich.
Kurz zusammengefasst, der komplette Film kam mir immens verlogen, unglaubwürdig in der Behandlung seines Themas (und besonders der Motivation der Figuren) vor. Auf jeden Fall Lichtjahre entfernt von anderen, tatsächlich provokanten, aber im Geist authentischen Darstellungen von jugendlichen Trends und Abgründen wie in Kids oder Spring Breakers.
Dann kommt ca. eine halbe Stunde vor Ende des Films die erste längere Szene, bei der man erstmals das Gefühl hat, dass die inszenatorischen Mittel halbwegs durchdacht angewandt werden und nicht nur daraufhin gewählt wurden, das Publikum immer wieder auf der Kurzstrecke wachzurütteln. Im Verlauf der Geschichte hat es sich ergeben, dass die sich zum Lynchmob entwickelnde Bevölkerung des Ortes (nur echt mit klischierten Redneck-Cops!) auf den Trichter kam, dass Lily hinter der Internet-Leakerei stecken könnte. Unsere vier Mädels befinden sich gerade im geräumigen Haus von Em (Sängerin Abra) und ihrer Mutter als man in kreiselnden Kamerafahrten das Innere des Hauses von außen sieht, aus der Sicht von bösen Invasoren, die die beginnende Panik der Mädchen beobachten und steigern. Das funktioniert zwar erzählerisch ganz gut, setzt einen als Zuschauer aber in die Position des Lynchmobs, der aus dem Finale des Films eine Art Variation von The Purge machen wird. Und damit hatte ich irgendwie ein Problem, was mir bei vergleichbaren Killer-P.O.V.s wie in Halloween, Friday the 13th etc. nie Magenschmerzen bereitet hatte.
Das größte Problem für mich bestand an dieser Stelle des Films darin, dass es mich eigentlich keinen Deut interessiert, wer jetzt im Showdown welches Schicksal erleiden wird. Für mich stand längst fest, dass ich diesen Film hasse, es ging eigentlich nur noch darum, wie sehr. Beim ersten Angriff auf das Haus setzte ich somit eine (nicht zwingend notwendige) Pinkelpause ein, kam dann wieder, als die Mutter zum Opfer geworden war und die Girls auf der Flucht war (es hätte sich ja auch irgendwie anders, interessanter entwickeln können) - und ich setzte mich für den Rest des Films ins Foyer, weil ich nach dem Film verabredet war. Die leicht gedämpfte Tonspur verriet mir, dass meine Wahl die richtige war.
Ich erfuhr (ungefragt) nach dem Film noch über einige Entwicklungen, die in meinen Augen aber auch nichts retten konnten (ehr im Gegenteil) und fragte noch einige Kollegen, ob sie den für mich am wenigsten nachvollziehbaren Moment des Films begriffen hätten: An einer Stelle wird mal eine Cheerleaderin (Nebenfigur) von einer anderen Nebenfigur mit einem Baseballschläger »erschlagen«, d.h. das Opfer bekommt einen Schlag an den Kopf. Später wird dann ein Mädchen, das ich nicht zweifelsfrei als Baseball-Täterin verhaftet und wir sehen ihre blutverschmierten Hände. Die Kollegen bestätigten, dass sie es auch so verstanden hatten, dass das wohl die selbe Tante gewesen sein soll, aus welchen Gründen sie aber blutverschmierte Hände haben soll (es gab nur einen Schlag mit dem Baseballschläger!), konnte mir keiner sagen.
Vielleicht war ich auch zu doof / unhip, um eine gewisse Ironie im Film als solche zu erkennen, aber die einzige Stelle, die über das gegenseitige Frotzeln zwischen den Figuren auf mich ironisch wirkte, war die, als (übrigens zweimal) von »LGBTQIAA« (oder LGTBAQIIA oder so ähnlich, auf jeden Fall mit einem Doppel-Vokal zwischendrin) gesprochen wurde. Mir ist bewusst (und ich habe mich auch schon vor Jahren darüber lustig gemacht), dass der Rattenschwanz der politisch korrekten Bezeichnung von sexuellen Minderheiten Opfer eines Wucherwachstums wurde, aber hier passt dieses Detail nur dazu, dass der Film auf mich den Eindruck macht, moderner und politisch korrekter sein zu wollen, als seine letztlich altbackene Machart es gestattet.
Es gab im Film noch viele kleine Dinge, die mich verärgert haben und an die ich beim Blick durch meine Notizen erinnert wurde - aber da ich sie bereits erfolgreich verdrängt hatte, wollte ich mich nicht künstlich erneut mit dem Geschmack meiner Galle anfreunden. Ist in meiner Jahres-Shitlist auf Platz 1 - und ich freue mich darüber, dass erstmals ein Film diesen Platz erklomm, den ich nicht zuende ertragen habe. Denn hin und wieder ärgere ich mich, dass ich Film verlassen habe, die vielleicht noch ein Quentchen Potential (juchhu, zwei alte Schreibweisen hintereinander) gehabt hätten, während ich absolute Drecksfilme bis zum Schluss durchgezogen habe.
Nachtrag zu den drei Abbruch-Filmen:
Die drei abgebrochenen Filme schafften es übrigens »teilgesichtet« recht ungefährdet auf Platz 13, 4 und respektive 1 meiner Work-in-Progress-Jahres-Shitlist. Ich weiß nicht warum, aber der November war als Kinostart-Monat für mich auffallend schrecklich (vielleicht auch die über eine kleine Erkältung hinaus beste Ausrede, warum ich mit meinen Kritiken auffällig hinterherhinkte). Platz 2 der Shitlist startet auch im November (zuende gesehen, darf ich aber wegen Sperrfrist noch nicht drüber reden). Sowohl, was Murksfilme, als auch, was abgebrochene PVen angeht, sind die November-Starts sowas wie der Elfenbeinturm - wenn man Tierschützer ist.
Demnächst in Cinemania 194 (Gefährliches Flattervieh):
Startaktuelle Rezensionen zu Anna und die Apokalypse (John McPhail), Die Erscheinung (Xavier Giannoli), Peppermint: Angel of Vengeance (Pierre Morel), Under the Silver Lake (David Robert Mitchell) und Die unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem Kleiderschrank feststeckte (Ken Scott).
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
 193:
193: