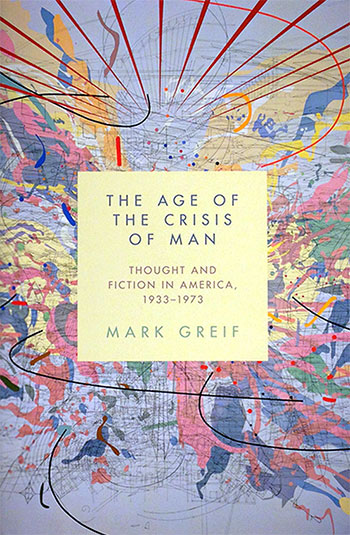| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
|
31. August 2015 |
Jörg Auberg
für satt.org |
||||

|
Die Dummheit des Gescheitseins»Das Gescheitsein wird hinfällig, sobald die Macht der Spielregel nicht mehr gehorcht und zur unmittelbaren Aneignung schreitet.« Max Horkheimer und Theodor W. Adorno,
Mark Greif gehört als Mitbegründer der New Yorker Zeitschrift »n+1« zu den »bright Boys« der intellektuellen Szene in den USA. Mit seinem ursprünglich als Dissertation konzipierten Buch »The Age of the Crisis of Man« möchte er nicht allein den Bogen von der Moderne in den 1930er Jahren bis zum Triumph der Postmoderne in den frühen 1970er Jahren schlagen, sondern auch in der Analyse von Philosophie und Literatur das Strandgut einer »brauchbaren Vergangenheit« für die Gegenwart retten. Ruiniert wird dieses Unterfangen jedoch durch Greifs intellektuelle Überheblichkeit, mit der er sich in nahezu jedem Satz in Szene setzen möchte. In seinem großen Spätwerk Midcentury (1961; dt. Jahrhundertmitte) beschrieb John Dos Passos, wie aus der romantischen Vergangenheit eine höllische Gegenwart wurde, ohne dass er die historischen Prozesse beleuchtete, die zu dieser Veränderung führten. »Der Mensch ist ein Wesen, das Institutionen baut«, heißt es an einer Stelle. Zentrales Thema des Romans ist aber auch, dass aus diesem kreativen Akt eine erstickende Umgebung entsteht, in der die Freiheit des Einzelnen liquidiert wird. Der Mensch regrediert zu einem »sozialen Insekt«.1 Die soziobiologischen Metaphern werden zu einem globalen Erklärungsmuster des Midcentury, in dem (wie der Literaturwissenschaftler Robert C. Rosen schrieb) Biologie zum Schicksal wird und sozialer Fortschritt unmöglich erscheint.2 Die immer monströser werdenden Institutionen mit ihren bürokratischen und medialen Apparaten lassen dem klassischen Helden Dos Passos', dem nonkonformistischen Wobbly (dem Mitglied der libertär-sozialistischen Gewerkschaft »Industrial Workers of the World«), keine Chance. Ähnlich pessimistisch sah Max Horkheimer in einer Notiz aus dem Januar 1968 die Gegenwart, die sich in seinen Augen als eine »Gesellschaft des Ameisenhaufens« darstellte. »Die Menschen werden sich bewußt sein«, schrieb Horkheimer, »daß sie nicht mehr bedeuten, als irgendeine bereits ausgestorbene Tierrasse auf dem Staubkörnchen Erde, das sich im Universum herumtreibt und in absehbarer Zeit, wenn sie auch noch Millionen Jahre entfernt ist, unbewohnbar werden wird.«3 Für den Historiker Lutz Niethammer, der sich als Repräsentant eines sozialdemokratisch aufgeladenen historischen Fortschrittsoptimismus in Szene setzte, signalisierten diese sozialbiologischen Metaphern die Kapitulation der Vernunft vor einem dunklen Zeitalter: Am Ende triumphiere das »Posthistoire«, eine »Welt ohne Möglichkeit zu einer dialektischen Praxis«, in der sich ein »Wille zur Ohnmacht« statt zur Veränderung manifestiere.4 In der Codesprache der Realpolitik hieß die Formel der »dialektischen Praxis« jedoch nichts anderes, als sich der Übermacht der Herrschaft unterzuordnen, während die Kritik der rationalen Destruktivität als realitätsuntauglich denunziert wird.
Die vier Jahrzehnte in den Jahren zwischen 1933 und 1973, in denen der Faschismus zeitweilig Triumphe feierte, das Atomzeitalter begründet wurde und das Individuum auf den Status einer beliebig ausradierbaren Nichtigkeit reduziert wurde, beschreibt Mark Greif in seinem Buch The Age of the Crisis of Man als eine Ära des Übergangs von der Moderne zur Postmoderne, wobei sich das Individuum in seiner atomisierten Form permanent in einem Zustand der Krise befindet. In den 1930er Jahren etablierte sich eine gängige Krisenliteratur, mit der Autoren wie John Dewey, Reinhold Niebuhr, Erich Kahler oder Sidney Hook auf politische und ökonomische Entwicklungen wie die »Große Depression« oder den um sich greifenden Faschismus reagierten. In seiner »Archäologie des amerikanischen Geistes« referiert Greif zwar die von Sidney Hook5 ausgelöste Diskussion und in der damals federführenden New Yorker Intellektuellenzeitschrift Partisan Review fortgesetzten Diskussion wider den »Obskurantismus« und die Feindschaft gegen Technik und Technologie, blendet dabei jedoch gänzlich Horkheimers Einwände gegen den US-amerikanischen Pragmatismus in seiner Kritik der instrumentellen Vernunft (1947) aus, die sich explizit auf Hook und die Debatte in der Partisan Review bezog. Zwar beleuchtet Greif auch Autoren wie Lewis Mumford und Dwight Macdonald, die im Zuge einer zunehmenden destruktiven Verbindung von Bürokratie und Technologie (wie sie sich 1945 im Einsatz der Atombomben ausdrückte) einen radikalen Wandel forderten, doch bewertet er seine archäologischen Ausgrabungen letztlich als Nichtigkeiten. Vor seinem elitären Auge können diese altmodischen, zuweilen radikalen Figuren nicht bestehen: Es sind ephemere Gestalten einer überholten Vergangenheit, die keine Beiträge zu einer »brauchbaren« Aufarbeitung der Geschichte leisten können, die Greif sich zur Aufgabe machte. In seiner rasternden Abtastung der historischen Oberflächen nimmt er politische und gesellschaftliche Aspekte der US-Gesellschaft wie den weitverbreiteten Rassismus oder die Internierung von Japano-Amerikanern nicht wahr, sondern kapriziert sich stattdessen auf die allgemeine Krise des Individuums. Da er mit der philosophischen Ausbeute seiner Ausgrabungen unzufrieden ist, wendet sich Greif der »Fiktion in Amerika« zu, wobei sich dieses »Amerika« auf die USA reduziert. Als Mitbegründer der New Yorker Zeitschrift n+1 sieht er sich in der Tradition der »alten« New Yorker wie Philip Rahv oder Irving Howe, die seit je auf der Jagd nach dem »Großen amerikanischen Roman« waren. So rekurriert er zunächst auf das Lamento, dass nach der »Lost Generation« nichts Adäquates folgte, wie der Literaturkritiker John Aldridge scheinbar schlüssig in seinem Buch After the Lost Generation (1951) darlegte. Als Beispiele eines ausgezehrten Modernismus führt Greif Ernest Hemingways Erzählung The Old Man and the Sea (1952; dt. Der alte Mann und das Meer) und William Faulkners messianisch durchdrungenen Roman A Fable (1954; dt. Eine Legende) an. In Greifs Augen thematisieren sowohl Hemingway als auch Faulkner einen Individualismus als Strategie der Errettung in einer Welt, in der realiter der Mensch zum nichtigen Anhängsel der Maschinerie regrediert ist. Auch Richard Wrights existenzialistischer Roman The Outsider (1953; dt. Die Mörder und die Schuldigen) hält Greifs Urteil nicht stand, da er inadäquat auf die vom Totalitarismus geschaffene Situation reagiere. Sein schmaler, eklektischer Kanon umfasst Autoren wie Ralph Ellison, Saul Bellow oder Thomas Pynchon, die in ihren Werken den philosophischen Komplex von Mensch, Geschichte und Technologie ergründen. Greifs Vorstellung der Literatur ist von der Idee einer intellektuellen Elite geprägt, die schon frühere Generationen der New Yorker Intellektuellen bestimmte. Greif geht es nicht um eine kollektive Literaturgeschichte, in der disparate, schichtenübergreifende Sensibilitäten zum Ausdruck kommen, sondern um die Manifestation einer auf die Wahrnehmung von Eliten gegründeten literarischen Realität. Zu Recht verwies Francis Mulhern auf das elitäre Grundkonzept von n+1, welches das konservative Kulturverständnis José Ortega y Gassets umstülpte, ohne die reaktionäre Form des Elitenbewusstseins zu hinterfragen.6
Im Schlussteil seines Buches durchschreitet Greif die 1960er Jahre in großen Siebenmeilenstiefeln, wobei er den Rassismus in der US-amerikanischen Gesellschaft, die Bürgerrechtsbewegung und die Revolte gegen das Establishment stichwortartig abhandelt, um schließlich zum »Antihumanismus« der Postmoderne gelangen, der die Vertreter des Universalismus als die wahren Verräter der Aufklärung denunziert. Das Problem der Greif’schen Vorgehensweise ist seinem von Eitelkeit und Ehrgeiz kontaminierten Manierismus geschuldet. Durch jede Zeile seines Buches, das letztlich seine Herkunft als Dissertation nicht verleugnen kann, wabert eine aufgeblasene, aufs Prestige abgezogene Zuschaustellung der eigenen Originalität, die den Autoren als herausragenden »Bright Boy« innerhalb der akademischen Zunft ausweisen soll, während die penetrante Ambition des vorgeblichen Bescheidwissers in ihren pompösen Ausmaßen das intellektuelle Unterfangen ruiniert. Tatsächlich ist die Schlussfolgerung, die am Ende des Buches zu finden ist, mehr als dürftig. Greif wird nicht müde, stets aufs Neue seine Originalität zu behaupten, und wartet am Ende mit einer Kritik des Universalismus auf, als hätte er sie wie Robinson Crusoe die Fußabdrücke am Strand zum ersten Mal entdeckt. Nach den weitschweifigen Exkursionen zu Dewey, Niebuhr, Hook, Macdonald, Ellison, Bellow und Pynchon findet er seinen Unterschlupf bei den »Meisterdenkern« einer Theorie-Überproduktion wie Michel Foucault, Jacques Derrida, Paul de Man und Claude Lévi-Strauss, die in den 1980er Jahren hierzulande unter dem Begriff der »Franzosentheorie« firmierte. Kritiker wie Cornelius Castoriadis nannten sie auch verächtlich die »ideologische Blechschmiede von Paris«. Der Ernst, mit der ein Spätgeborener wie Greif den Antihumanismus der »Franzosentheorie« nun aufgreift, entbehrt nicht der Komik, die etwas an den geschwätzigen Besserwisser Paul in Woody Allens Komödie Midnight in Paris erinnert. »Die Franzosentheorie, die mit Frankreich so viel zu tun hat wie das Franzosenbrot aus dem deutschen Kaufhaus mit der Baguette aus meiner Boulangerie, sollte man, finde ich«, schrieb Lothar Baier 1985, »vor allem mit Humor und Nachsicht behandeln [...].«7 Diese selbstironische Eigenschaft wird man jedoch bei einem nachgeborenen intellektuellen Elitär, der offenbar nichts von der intellektuellen Kritik der Intellektuellen (wie sie unter anderem Jean-Paul Sartre und Theodor W. Adorno formulierten) begriffen hat, kaum finden.
|
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |