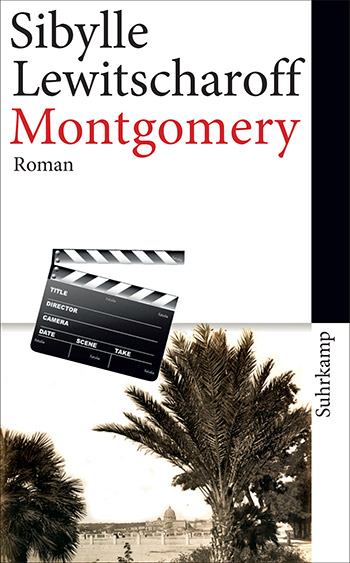| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
25. Juli 2017 | Gunther Nickel für satt.org |
||
 |
Noch einmal: „Jud Süß“Sibylle Lewitscharoffs Roman Montgomery im Kontext der Jud Süß-Darstellungen von Wilhelm Hauff bis Veit HarlanIn Sibylle Lewitscharoffs Roman Montgomery wird eine Fülle von Stoffen und Motiven aufgegriffen, die auf den ersten Blick nicht recht zusammenzupassen scheinen. Man kann das Buch sowohl als Rom- als auch als Stuttgart-Roman lesen. Es handelt von der Biographie eines Filmproduzenten und enthält deshalb Ausflüge in die Filmgeschichte, es kreist aber auch um eine sich langsam anbahnende Liaison zwischen dem Filmproduzenten, der schon etwas reifer an Jahren ist, und einer erheblich jüngeren Holländerin. Thematisiert werden diverse gesundheitliche Leiden des Helden, die zum Teil das Alter mit sich bringt, die mißlichen Folgen übermäßigen Alkoholkonsums, die dann in Lewitscharoffs nächstem Roman Consummatus nochmals eine Rolle spielen, aber auch die verbreitete Liebe zum Haustier kommt gebührend zur Sprache. So hat des Protagonisten Mutter eine Vorliebe für Dackel und die römische Haushälterin für einen Wellensittich. Daneben geht um einen Brudermord, um die NS-Zeit in Württemberg, um den Einzug der Vertriebenen ins „Ländle“ nach dem Zweiten Weltkrieg und die Rolle der (vor allem italienischen) Gastarbeiter im Schwaben der 1970er Jahre. Als sei dies noch nicht genug, befaßt sich dieser Roman auch noch mit dem Jud Süß genannten Joseph Süß Oppenheimer, der im 18. Jahrhundert Finanzberater des württembergischen Herzogs Karl Alexander war und dessen Lebensgeschichte einer Novelle von Wilhelm Hauff, einem Roman von Lion Feuchtwanger und einem antisemitischen Film von Veit Harlan zugrunde liegt. Man muß zugeben, es sind wirklich – zumal hier noch nicht einmal alle aufgezählt sind – ziemlich viele Stoffe und Motive, die in diesemRoman zusammengeführt werden. Daher ist man leicht versucht, Kritikerinnen und Kritikern wie Verena Auffermann und Eberhard Rathgeb beizupflichten, die Sibylle Lewitscharoff im einen Fall mehr, im anderen weniger freundlich attestiert haben, dem Buch fehle es an thematischer Konzentration. Ja, Montgomery sei, so Rathgeb wörtlich, „ein glatter Durchbruch in den Schmock". „Hanebüchen und dick“ sei die Geschichte, „mickrig und banal“ seien die Figuren. „Verzuckert und verzogen“ sei die Sprache.“[1] Die Überprüfung dieses Urteils verlangt, daß ich ein wenig aushole. Zur Orientierung will ich kurz skizzieren, was im folgenden zur Sprache kommt: Beweisen möchte ich – oder sagen wir lieber: plausibel machen, daß man Sibylle Lewitscharoffs Roman Montgomery zu allererst als Fortsetzung der Tradition der Jud Süß-Darstellungen von Wilhelm Hauff bis Veit Harlan lesen sollte. Ich will mit anderen Worten zeigen, daß sich selbst die eigentümliche Vorliebe, die des Protagonisten Mutter für Dackel hegt, dann als völlig stimmige und organische Romanzutat erklären läßt. Ich gehe sogar soweit, in leichter Abwandlung eines Bonmots von Max Horkheimer zu sagen: Wer über den Jud Süß-Stoff reden will, sollte auch über Dackel in Stuttgart-Degerloch nicht schweigen. I. Der historische StoffEin Jahr, bevor er Herzog wurde, hat Karl Alexander von Württemberg den Frankfurter Bankier und Finanzmakler Joseph Süß Oppenheimer zum Hof- und Kriegsfaktor bestellt. Seine ausschließliche Aufgabe war es, für die Ordnung der prekären Finanzsituation Karl Alexanders zu sorgen. Diese Aufgabe erfüllte er so erfolgreich, daß Oppenheimer 1736 zum Geheimen Finanzrat und politischen Berater des Herzogs berufen wurde. Das war eine heikle Konstellation, denn der Herzog war katholisch, Oppenheimer ein Jude und das württembergische Bürgertum protestantisch. Da der Herzog die von Oppenheimer vorgeschlagenen Reformen im Finanz- und Steuerwesen absolutistisch dekretierte statt sie so, wie es die Verfassung vorsah, mit den Landständen abzustimmen, vermengten sich schnell politische und konfessionelle Spannungen. Nachdem Karl Alexander bereits 1737, ein Jahr nach Übernahme der Herzogswürde, an den Folgen eines Schlaganfalls starb, konzentrierte sich der gesamte Unmut mit der Fiskalpolitik (aber nicht nur mit ihr) auf die Person Oppenheimers. Er wurde verhaftet und wegen Hochverrats, Beraubung der staatlichen Kassen, Bestechlichkeit und Schändung der protestantischen Religion angeklagt und des sexuellen Umgangs mit Christinnen bezichtigt. In einem rot gestrichenen Käfig stellte man ihn zur Schau. Das Angebot der Begnadigung, das an die Bedingung geknüpft war, daß er zum Christentum übertrete, lehnte er ab. So wurde er am 4. Februar 1738 vor rund 12.000 Zuschauern auf der Prag, dem Stuttgarter Hinrichtungsplatz, gehängt. Die Leiche verblieb anschließend bis 1744 in dem eisernen Käfig, in dem er zuvor gefangen gehalten worden war. Er sollte, wie es sich der Stuttgarter Geheimrat von Pflug ausgedacht hat, nicht wie andere, die zum Tod am Galgen verurteilt waren, frei hängen, sondern wie ein Vogel im Käfig.[2] II. Wilhelm Hauffs NovelleWilhelm Hauffs Novelle behandelt diese Vorgänge sehr frei, stattet Oppenheimer zum Beispiel mit politischen Befugnissen aus, die er nie hatte. Er erfindet zudem eine Liebesgeschichte zwischen dem jungen Württemberger Gustav Lanbek und Lea, der schönen Schwester Joseph Süß Oppenheimers, dem eine solche Verbindung aus politisch-strategischen Gründen sehr zupaß kommt und der sie daher auch intrigant zu befördern versucht. Gustavs Vater, der Landschaftskonsulent Lanbek, ist allerdings bis zur Fremdenfeindlichkeit patriotisch gestimmt; schon der Gedanke an eine solche Liebesbeziehung erscheint ihm unerträglich. Aus Pflichtgefühl ihm gegenüber und ohne die geringste Neigung verleugnet sein Sohn seine Liebe nicht weniger als dreimal auf erbärmliche Weise, hilft Lea am Ende auch nicht, als sie Gustav darum bittet, ein Papier verschwinden zu lassen, das ihren Bruder belastet. Nach der Hinrichtung Oppenheimers begeht Lea Selbstmord, indem sie sich im Neckar ertränkt. Gustav wird seines Lebens nicht mehr froh und flüchtet sich kompensatorisch in metaphysische Betrachtungen. Neben den familiären Konflikt, der die Liebe zwischen Lea und Gustav auslöst, treten zwei weitere, die Hauff beide erfunden hat: Zum einen will Oppenheimer die Landstände aller Rechte berauben, und die waren in Württemberg weitreichend und beschränkten die Herrschaft des Herzogs erheblich. Zum anderen beabsichtigt Oppenheimer, einen Konfessionswechsel des Landes vom Protestantismus zum Katholizismus herbeiführen. Der alte Lanbek ist also gleich dreifach vom Wirken Oppenheimers betroffen: als Familienoberhaupt, in seiner gesellschaftlichen Stellung als Landschaftskonsulent und als Protestant. Es ist somit kein Wunder, daß er Oppenheimers Hinrichtung befürwortet. Während Lea als über alle Maßen schön und auch sonst in jeder Hinsicht liebenswert charakterisiert wird, erscheint ihr Bruder als geldgierig, hinterlistig, skrupellos, arrogant und lüstern. Man sieht, daß Hauff sich hier aller nur greifbaren antisemitischen Stereotypen bedient hat. Ob sie ihm indes auch dazu dienen sollten, Antisemitismus zu befördern, ist in der Forschungsliteratur umstritten. Ich neige in diesem Fall zur Vorsicht mit der Unterstellung einer antisemitischen Absicht, denn die Figur, die in dieser Novelle Ursache und Zentrum aller Zwistigkeiten ist, ist nicht Oppenheimer, sondern der Herzog. Am Ende des Textes distanziert sich der Erzähler daher auch ohne Wenn und Aber vom Urteil gegen Oppenheimer und seiner Vollstreckung: „Man wäre versucht“, heißt es dort, „das damalige Württemberg der schmählichsten Barbarei anzuklagen, wenn nicht ein Umstand einträte, den Männer, die zu jener Zeit gelebt haben, oft wiederholen, und der, wenn er auch nicht die Tat entschuldigt, doch ihre Notwendigkeit darzutun scheint. ‚Er [Joseph Süß Oppenheimer] mußte’, sagen sie, ‚nicht sowohl für seine eigenen schweren Verbrechen als für die Schandtaten und Pläne mächtiger Männer am Galgen sterben.’ Verwandtschaften, Ansehen, heimliche Versprechungen retteten die andern, den Juden – konnte und mochte niemand retten, und so schrieb man, wie sich der alte Landschaftskonsulent Lanbek ausdrückte, ‚was die übrigen verzehrt hatten, auf seine Zeche.’“[3] Der Marbacher Literaturwissenschaftler Helmuth Mojem hat in einer bemerkenswerten Studie über Hauffs Novelle gezeigt, daß diese Version des Textes, die allen Buchausgaben zugrunde liegt, an einer bezeichnenden Stelle vom Erstdruck in dem von Hauff redigierten „Morgenblatt für gebildete Stände“ abweicht. Dort ist nämlich nicht von den Schandtaten und Plänen „mächtiger“, sondern „mächtigerer Männer“ die Rede. „Da Hauff“, meint Mojem, „den Minister in seiner Novelle als schier allmächtig gezeichnet hat, kann mit diesem Komparativ eigentlich nur der württembergische Herzog gemeint sein.“[4] Aber Mojem geht noch weiter: Tatsächlich ziele der Text gar nicht auf Karl Alexander. Er ziele vielmehr auf den 1816 ebenfalls überraschend verstorbenen König Friedrich, der 1805 mit Billigung und Unterstützung Napoleons genau das gemacht hat, was Karl Alexander von Hauff als Absicht nur angedichtet wurde: Er schaffte die Landstände und damit das, wie es von Uhland in seinen „Vaterländischen Gesängen“ besungen wurde, „gute alte Recht“ ab. Erst nach Napoleons Niederlage in den Befreiungskriegen sah sich Friedrich gezwungen, wieder einen Landtag einzuberufen, dem er im März 1815 eine neue Verfassung präsentierte. Der Landtag lehnte sie jedoch ab und setzte sich nachdrücklich für die Wiederherstellung der alten Verfassungsrechte ein, unter anderem für die Mitsprache bei Kriegen und Steuererhebungen. Nach vielem Hin und her, nachdem auch eine – im Deutschland des 19. Jahrhunderts einzigartige – Volksabstimmung gescheitert war, einigten sich 1819 ein neu gewählter Landtag und Wilhelm I. auf einen Verfassungskompromiß. Das „alte Recht“ hatte indes auch prominente Gegner, unter ihnen den Philosophen Hegel, der es in einer 1816 erschienen Streitschrift scharf kritisierte, weil es Privilegien verfestige und damit Klüngelei Vorschub leiste.[5] Hauff dagegen plädierte für eine Kontrolle und Beschränkung absolutistischer Vollmachten durch die Landstände. Seine Novelle ist quasi eine verkappte Sympathieerklärung für das „alte Recht“, für die der Jud Süß-Stoff gleichsam das Einwickelpapier lieferte. Daß man seinen Text auch anders lesen konnte und, vor allem in der NS-Zeit, anders gelesen hat, steht auf einem anderen Blatt. III. Lion Feuchtwangers RomanAusgangspunkt für Lion Feuchtwangers Jud Süß war die Absicht, einen Roman über Walther Rathenau zu schreiben, und zwar nicht in erster Linie über den Juden Rathenau, sondern über die ambivalente Erscheinung des modernen kapitalistischen Erfolgsmenschen. Da er mit diesem Vorhaben scheiterte, griff er statt dessen auf die Geschichte Joseph Oppenheimers zurück, weil sie mit historischem Abstand besser zu beschreiben erlaubte, worum es ihm zu tun war; die Linien eines Gebirges, erklärte er 1929, erkenne man aus der Entfernung besser als im Gebirge. Das Judentum des Jud Süß ist jedoch keine akzidentelle Zutat. Es ist auch bei ihm Voraussetzung, um ihn mit Hilfe antisemitischer Stimmungsmache stigmatisieren zu können. Die Pointe in Feuchtwangers Roman ist freilich, daß „Jud Süß“ Resultat eines Seitensprungs zwischen seiner Mutter und einem eindeutig nichtjüdischen Feldmarschall namens Georg Eberhard von Heyersdorff ist. Oppenheimer beschließt aber, seine erworbene soziale Identität aufrechtzuerhalten, weiterhin als Jude aufzutreten, mithin seine sowohl christliche als auch adelige Abstammung zu verheimlichen. Feuchtwanger nimmt seinen Protagonisten sowenig in Schutz wie das gesamte andere Personal seines Romans. Wie bei Hauff ist Jud Süß berechnend, opportunistisch und machtbesessen, was unter manchen Kritikern und Literaturwissenschaftlern zu großer Besorgnis geführt hat, der Roman könne trotz der nichtjüdischen Herkunft seines Protagonisten Antisemitismus befördern. Nach dem Zweiten Weltkrieg zögerten Verlage in Ost und West aus diesem Grund auch bis in die 1950er Jahre damit, das Buch erneut aufzulegen. In der Weimarer Republik war der Erfolg zunächst mäßig. Ein Theaterstück, das dem Roman vorausging und 1917 entstand, erntete fast ausnahmslos schlechte Kritiken. Der 1922 fertiggestellte Roman fand erst keinen Verleger, bis sich der Drei-Masken-Verlag 1925 erbarmte und aus dem Manuskript ein Buch machte, und das eigentlich auch nur, weil man sich auf diese Weise einer anderen vertraglichen Verpflichtung gegenüber Feuchtwanger entledigen konnte. Der Absatz der 6.000 hergestellten Exemplare verlief schleppend, bis der amerikanische Verleger Ben Huebsch 1926 eine Lizenz erwarb und die Übersetzung in den USA und England nach begeisterten Rezensionen zu einem Bestseller wurde. Nun stieß das Buch plötzlich auch in Deutschland auf Interesse, und es wurden bis 1933 rund 300.000 Exemplare verkauft, davon 2/3 in einer bearbeiteten und gekürzten Fassung im Knaur Verlag. IV. Veit Harlans FilmLange Zeit war die irrige Ansicht verbreitet, der 1940 von Veit Harlan gedrehte Film „Jud Süß“ basiere auf Feuchtwangers Roman. Auch Feuchtwanger selbst glaubte das, als er im Exil von diesem Film hörte und sich daraufhin in einem „Offenen Brief an sieben Berliner Schauspieler“ zu Wort meldete. Darin heißt es: „Meine Herren, ich lese im ‚Völkischen Beobachter’, daß Sie die Hauptrollen gespielt haben in einem Film ‚Jud Süß’, der in Venedig preisgekrönt worden ist. Der Film zeigt, berichtet das Blatt, das wahre Gesicht des Judentums, seine unheimliche Methodik und vernichtende Zielsetzung; er zeigt das unter anderem dadurch, daß er vorführt, wie der Jude Süß sich eine junge Frau durch die Folterung ihres Gatten gefügig macht. Kurz, wenn ich das geschwollene, am Bombast des ‚Führers’ geschulte Geschwafel ins Deutsche übersetze, dann bedeutet es: Sie haben, meine Herren, aus meinem Roman ‚Jud Süß’ mit Hinzufügung von ein bißchen Tosca einen wüst antisemitischen Hetzfilm im Sinne Streichers und seines ‚Stürmers’ gemacht. Sie alle kennen meinen Roman ‚Jud Süß’. Fünf von Ihnen, soviel erinnere ich mich bestimmt, Sie können es aber auch alle sieben gewesen sein, haben in Bühnenbearbeitungen dieses meines Romans gespielt. Sie haben, über Einzelheiten mit mir diskutierend, gezeigt, daß Sie das Buch verstanden haben; Sie haben in Worten der Bewunderung darüber gesprochen.“[6] Feuchtwanger hatte recht damit, von einem antisemitischen Hetzfilm im Sinne Streichers zu sprechen. Aber mit seinem Roman hat er nicht allzu viel gemeinsam, eigentlich nur dies, daß auch er überaus erfolgreich war: In den ersten 27 Tagen nach der Uraufführung im Berliner Ufa Palast am Zoo kamen 110.006 Besucher. Bis 1943 sahen ihn 20,3 Millionen Zuschauer. Er spielte knapp 6 Millionen Mark ein und gehörte damit zu den erfolgreichsten deutschen Kinoproduktionen der Jahre 1940 bis 1942. Die von Goebbels gewünschte antisemitische Wirkung blieb nicht aus. „Einmal, es mag Ende 1940 gewesen sein“, zitiert Friedrich Knilli in seiner instruktiven Studie „Ich war Jud Süß“ einen damaligen Freund des späteren Schriftstellers und Publizisten Ralph Giordano, habe ich mit Giordano zusammen den Film Jud Süß gesehen. Dieser Film beeindruckte mich sehr stark und ich bekam dadurch einen heftigen Abscheu gegen die Juden. Infolgedessen habe ich mit Giordano vollständig gebrochen und habe auch an dem Abend der Filmvorführung kaum noch mit ihm gesprochen. Es ist auch richtig, dass ich ihm zum Abschied nicht die Hand gegeben habe. Ich habe mich vollständig vom ihm zurückgezogen.[7] Knilli hat jedoch auch Quellen aufgespürt, die von tief empfundenem Mitleid und Sympathie mit dem von Ferdinand Marian dargestellten Jud Süß bei Zuschauern dieses Films zeugen. Körbeweise erhielt er Liebesbriefe von begeisterten Kinogängerinnen. Auch der umstrittene Staatsrechtler Carl Schmitt zweifelte an der propagandistischen Wirksamkeit des Films. Er schrieb am 29. September 1940 an Ernst Jünger: Vorigen Dienstag war ich in der Premiere des neuen Films „Jud Süss“. Ich empfehle Ihnen sehr, sich das anzusehen. Es ist überaus aufschlußreich, in vielen Hinsichten, wenn auch vielleicht nicht so, wie seine Urheber es beabsichtigten.[8] Der Film war mit den besten Schauspielern besetzt, die zu dieser Zeit in Deutschland zu haben waren: Heinrich George spielte den Herzog, Eugen Klöpfer den Landschaftskonsulenten Sturm, Kristina Söderbaum dessen Tochter, die von Jud Süß zum Geschlechtsverkehr gezwungen wird und sich daraufhin ebenso ertränkt wie Oppenheimers Schwester Lea in Hauffs Novelle. Allein die Chuzpe, mit der hier aus einem jüdischen Opfer bei Hauff kurzerhand ein deutsches Opfer gemacht wird, ist bezeichnend für den eklektizistischen Umgang mit der Stofftradition. Der Film hatte nach dem Zweiten Weltkrieg mehrere gerichtliche Nachspiele. Weil Werner Krauß für das außergewöhnlich hohe Honorar von 50.000 Mark insgesamt fünf jüdische Nebenrollen verkörperte hatte, wurde gegen ihn ein Spruchkammerverfahren in Stuttgart durchgeführt. Krauß versuchte dabei deutlich zu machen, er sei von Reichspropagandaminister Goebbels unter erheblichen Druck gesetzt worden und habe sich wie Ferdinand Marian der ihm angetragenen Aufgabe schließlich nicht mehr entziehen können. Während Marians Widerstand gegen eine Mitwirkung an diesem Film durch Goebbels’ Tagebücher bestätigt wird, gibt es dort entsprechende Einträge über Krauß jedoch nicht. Das Spruchkammerverfahren gegen Krauß, in dem viele Prominente zu seinen Gunsten aussagten,[9] wurde 1948 mit Einstufung als „Mitläufer“ abgeschlossen. Nach mehr als drei Jahren Berufsverbot war er am 18. November 1948 erstmals wieder auf der Bühne zu sehen. In Deutschland trat er nach dem Zweiten Weltkrieg erstmals im November und Dezember 1950 auf. In Berlin kam es deswegen zu heftigen Protesten. Zuvor hatten in Hamburg Gerichtsverfahren gegen den Regisseur Veit Harlan stattgefunden. Zunächst wurde er in einem Schwurgerichtsverfahren der „Beihilfe zur Verfolgung“ für schuldig befunden, im April 1950 aber vor dem Landgericht Hamburg freigesprochen. Die Richter folgten seiner Beteuerung, er sei zur Regie gezwungen worden und eine Weigerung hätte ihn in eine bedrohliche Lage gebracht. V. Sibylle Lewitscharoffs MontgomeryIn Sibylle Lewitscharoffs Roman, der in der jüngst vergangenen Gegenwart um die Jahrtausendwende spielt, scheinen verschiedene Konfliktlinien des Jud Süß-Stoffes wieder auf. Sie erfahren bei ihrer Adaption und Verlängerung in die Gegenwart jedoch eine zum Teil erhebliche Modifikation. Zunächst einmal ist die Hauptfigur kein Jude, was auch ganz folgerichtig ist, denn: „Juden gab es so gut wie keine mehr.“ Sie ist auch nicht im Finanzwesen tätig, sondern trägt nur als Filmproduzent Budgetverantwortung. Sie ist halber Deutscher und halber Italiener – Sohn des italienischen Photographen Alessandro Cassini und einer Schwäbin – und nimmt in Familie und Heimatstadt trotz schwäbischer Sozialisation eine Außenseiterstellung ein. Schon ihr ungewöhnlicher Name, Montgomery Cassini-Stahl, markiert ihre gesellschaftliche Exterritorialität. Wie es zu diesem Namen kam, wird im Roman folgendermaßen erläutert: Aus Begeisterung für den jungen Montgomery Clift in Red River, der dahergeritten kam auf der Leinwand des New Eden am Burgholzhof und ihm vormachte, wie sich ein kleiner schmächtiger Kerl wehrte, hatte er [Montgomerys italienischer Vater] die für seinen zweiten Sohn vereinbarten Vornamen, Karl Eberhard Friedrich – Karl nach dem alten Stahl, Eberhard nach dessen Vater und Friedrich nach dem im ersten Weltkrieg gefallenen Bruder –, auf dem Standesamt fallenlassen und Montgomery dafür eingesetzt. Schwabenohren hörten in diesem Namen natürlich keinen anderen als den des Helden von El Alamein, der ihren geliebten und verehrten Rommel in die Knie gezwungen hatte. Für den alten Stahl, der sich um die Weitergabe des eigenen Vornamens geprellt sah und das zugunsten eines Namens, der ihm ständig die Schmach Rommels in Erinnerung brachte, war dies ein doppelter Affront.[10] Obwohl das im Roman nirgends gesagt wird, ist es die Erfahrung, qua Geburt ein Zugehöriger und zugleich ein Außenseiter zu sein, die das Interesse von Montgomery Cassini-Stahl am Jud Süß-Stoff motiviert. In Rom will er ihn neu verfilmen. Kommt seine schwäbisch-italienische Mischidentität mit einem in Cinecittà verfilmten Stoff aus seiner Heimat voll zum Tragen, so verfilmt er ihn aber durchaus mit jenem schwabenkritischen Impetus, den er schon mit seiner Berufswahl an den Tag legte. Denn diese folgte ja den väterlichen (also italienischen) und nicht der großväterlichen (also schwäbischen) Assoziation beim Namen Montgomery. Daß er bei dieser Verfilmung alle bisherigen literarischen und filmischen Bearbeitungen außen vor lassen, sich vielmehr nur auf die historische Figur des Joseph Süß Oppenheimer beziehen will, ist bei seinen Zielen nur zu verständlich: Er möchte diesem Außenseiter offenbar endlich zu einer gerechten Darstellung in einem populären Medium verhelfen und damit der historischen Wahrheit wirksam Genüge tun. Denn noch ihn selbst hatte als Jugendlichen der bloße Titel „Jud Süß“ auf einem Buchrücken, den er in der Bibliothek eines amerikanischen Besatzers sah, elektrisiert: „Er wußte“, heißt es im Roman, „Jud Süß war ein schlimmer Film. Und dieses halbgare Wissen zündete einen Kurzschluß. Das Buch war giftig. Es war gefährlich und bestimmt verboten. Wer so etwas besaß, mußte ein Nazi sein; also war der Amerikaner insgeheim ein Nazi. [...] Das Buch gab ihm einen bösen Kuß. Er schämte sich dafür, einem Nazibuch auf den Leim gegangen zu sein. Daß es einen Unterschied zwischen Buch und Film geben könnte, auf die Idee kam er nicht.“ Als er Überlegungen zu einem eigenen Jud Süß-Film anstellt, weiß er selbstverständlich um den Unterschied. Feuchtwanger will er aber nicht folgen, weil er es wichtig findet, alle Dämonie zu vermeiden, mit der dieser noch seinen Jud Süß ausgestattet hat. Schlecht weg kommen sollen bei ihm vor allem der Herrscher Württembergs und mehr noch die Landstände, die als „verbissen protestantisch“ bezeichnet werden und einem „zum Weinerlichen und Kümmerlichen neigenden Pietismus“ anhängen: „Der evangelische Filz, wie er leibt und lebt.“ An diesen Schwaben wird wirklich kein gutes Haar gelassen – ein Fall von schwäbischem Selbsthaß, ohne jede Rücksicht auf das demokratische Moment, das die Existenz der Landstände doch auch mit sich brachte? Das ist zu vermuten. Jedenfalls entschließt sich Montgomery Cassini-Stahl, Stuttgart zu verlassen und in Rom zu leben, freilich ohne seine schwäbischen Prägungen verleugnen oder seine familiären Bindungen ganz lösen zu können oder zu wollen. Wenn Verena Auffermann in ihrer Rezension also meint, Sibylle Lewitscharoff hätte sich nicht mit Rom verzetteln, sondern auf Stuttgart konzentrieren sollen,[11] verkennt sie völlig, daß für diesen Roman beide Schauplätze deshalb konstitutiv sind, weil sie für Cassini-Stahls gespaltene schwäbisch-italienische Identität einstehen. Daß auch eine Liebesgeschichte vorkommt und Cassini-Stahl ausgerechnet nach der ersten Liebesnacht stirbt, kann ebenfalls kein Zufall sein. Gezeigt wird allerdings das glatte Gegenteil des ausschweifenden Lebens, das Joseph Süß Oppenheimer nachgesagt wird; allein schon Cassini-Stahls gesundheitliche Verfassung wäre auch gar nicht danach: wegen seines empfindlichen Magens trinkt er morgens immer nur Malzkaffee und ißt Brei. Und sein anstrengendes Dasein als Filmproduzent, das ihm für private Eskapaden kaum Zeit läßt, sorgt dafür, daß die Zahl seiner Liebesabenteuer klein bleibt. Wer einwenden sollte, Cassini-Stahl habe hierin nun doch gar nichts mehr mit Jud Süß gemein, es bestehe daher nicht die geringste Motivähnlichkeit, dem läßt sich erwidern: Im Roman klingen alle Motivkomplexe an, die für den Jud Süß-Stoff wesentlich sind, sie werden aber alle variiert, mitunter auch einfach banalisiert. Das geschieht zum einen, weil die Zeit fortgeschritten ist und zum anderen, weil sich vergleichbare historische Konstellationen tatsächlich nie gleichen, sondern immer nur ähneln. Noch das Motiv des Vogelkäfigs, in dem der historische Jud Süß aus symbolischen Gründen aufgehängt wurde, scheint von ferne auf, wenn von dem Käfig mit dem Wellensittich Buzzi die Rede ist, der der Zugehfrau des Regisseurs gehört und ein recht munteres Leben führt. Buzzi lenkt des Lesers Aufmerksamkeit sogleich auf die Frage, welche anderen Vorlieben für Tiere die Protagonisten in diesem Roman haben und auf welche Weise sie das charakterisiert: Montgomery Cassini-Stahl begeistert sich als Jugendlicher für Reptilien und Insekten, neigt also passend zu seinem Außenseitertum zum Exotismus, während seine Mutter sich einen Dackel hält, der mit seinem ausgeprägten Eigensinn jenen Charakterzügen, die den Schwaben nachgesagt werden, kongenial entspricht. Die Assoziationen, die der Vogelkäfig ausgelöst hat, erscheinen daher allenfalls auf den ersten Blick beliebig; bei genauerem Hinsehen erweisen sie sich als ganz stimmig und auch mit einer gehörigen Portion Schalk in den Roman integriert. Eine entscheidende Information bleibt noch nachzutragen: Alles, was wir über Montgomery Cassini-Stahl erfahren, erfahren wir nur aus der Perspektive eines selbsternannten und allem Anschein nach falschen Freundes namens Rolf; bezeichnenderweise spricht er selber von einer „posthumen“ Freundschaft. Dieser Erzählrahmen bewirkt, dass alles, was hier bislang über den Roman gesagt wurde, zwar nicht unrichtig wird, aber doch eine neue Perspektivierung bekommt, denn es ist zweifelhaft, was wir diesem Erzähler überhaupt glauben dürfen, der mindestens eine Situation offenkundig völlig abwegig deutet. Die Einführung eines unzuverlässigen Erzählers ist ein erprobter Schachzug, und es spricht nichts dagegen, sich eines solchen, bestens bewährten Spielzugs nochmals zu bedienen. Hier vermag er einen verständigen Leser dazu zu animieren, sich selbst auf die Suche nach der historischen Wahrheit des Jud Süß-Stoffes zu machen, weshalb sich am Ende des Romans auch ein weiterführender Literaturhinweis findet –, oder aber zu überlegen, was dieser Stoff trotz Ermangelung eines sogenannten jüdischen Problems in der schwäbischen Gegenwart doch noch an Gegenwärtigkeit besitzt, und das durchaus nicht nur in Schwaben, sondern auch über Schwaben hinaus. Eine solche Gegenwärtigkeit besitzt er dadurch, daß die psychologischen Mechanismen und die narrativen Strategien, mit denen Außenseiter dämonisiert und damit noch mehr zum Außenseiter gemacht werden, immer noch die gleichen sind wie zur Zeit Karl Alexanders von Württemberg. Denn was, fragt sich doch, treibt diesen Erzähler, dem wir 347 Seiten gefolgt sind, eigentlich zum Erzählen? Warum erklärt er erst reichlich unglaubwürdig, noch von Cassini-Stahl selbst zum Chronisten seines Lebens berufen worden zu sein, um dann als erstes nichts weniger als ein Verbrechen zu enthüllen, das von Cassini-Stahl in seiner Jugend angeblich begangen worden sei: Er soll seinen kranken, an einen Rollstuhl gefesselten Bruder aus purem Neid auf dessen familiäre Bevorzugung in einen Swimmingpool geschubst und so vom Leben zum Tode befördert haben. Cassini-Stahls Mutter versichert indes, Montgomery Cassini-Stahl sei „gar nicht da“ gewesen. Und sie zweifelt auch sonst an der ihr wie uns Lesern dargebotenen Lebensbeschreibung, indem sie spöttisch konstatiert, daß der Chronist ja sogar in die Gehirnwindungen ihres Sohnes zu kriechen vermocht habe und so tue, als ob er sich selbst in dessen Träumen auskenne. Mit diesem Ende rückt die Lebensgeschichte Cassini-Stahls plötzlich ganz in den Hintergrund und die Narration sowie die Motivation zu dieser Narration in den Mittelpunkt. Oder anders gesagt: Zur wahren Hauptfigur dieses Romans wird nun der Erzähler, und dieser ist unter anderem deshalb eine fragwürdige Hauptfigur, weil er uns lauter Mutmaßungen und höchst problematische Interpretationen als Tatsachen auftischt. So widerfährt Cassini-Stahl durch seinen Biographen das, was in allen literarischen und filmischen Adaptationen des Jud Süß-Stoffes Joseph Oppenheimer ebenfalls widerfahren ist: seine Lebensgeschichte wird mit Fiktionen ausgeschmückt. Im Fall von Jud Süß, der ja anders als Montgomery Cassini-Stahl keine Erfindung ist, verfügen wir zwar auch über historische Fakten, aber die historische Faktizität ist fiktional überformt und wird im kollektiven Gedächtnis weithin immer noch in dieser Überformung bewahrt.
[1] Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. März 2003. [2] Zum historischen Fall „Jud Süß“ vgl. Selma Stern, Jud Süß. Ein Beitrag zur deutschen und jüdischen Geschichte, Berlin 1929; Barbara Gerber, Jud Süß. Aufstieg und Fall im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur historischen Antisemitismus- und Rezeptionsforschung, Hamburg 1990; Hellmut G. Haasis, Joseph Süß Oppenheimer, genannt Jud Süß. Finanzier, Freidenker, Justizopfer, Reinbek bei Hamburg 1998. [3] Wilhelm Hauff, Werke, hrsg. von Bernhard Zeller, Frankfurt am Main 1969, Bd. 1, S. 559. [4] Helmuth Mojem, Heimatdichter Hauff? Jud Süß und die Württemberger, in: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft, Jg. 48, 2004, S. 143-166. [5] G. F. W. Hegel, Verhandlungen in der Versammlung der Landstände des Königreichs Württemberg im Jahr 1815 und 1816, in: Ders., Werke in zwanzig Bänden, hrsg. von Karl Markus Michel und Eva Moldenhauer, Frankfurt am Main 1970, S. 462-597. [6] Zit. nach: Lion Feuchtwanger, Ein Buch nur für meine Freunde, Frankfurt am Main 1984, S. 526-532. [7] Friedrich Knilli, Ich war Jud Süß. Die Geschichte des Filmstars Ferdinand Marian, Berlin 2000, S. 154 f. [8] Ernst Jünger / Carl Schmitt, Briefe 1930-1983, hrsg. von Helmuth Kiesel, Stuttgart 1999, S. 105. Zur tatsächlichen Ambivalenz des Films vgl. Anke-Marie Lohmeier, Propaganda als Alibi. Rezeptionsgeschichtliche Thesen zu Veit Harlans Film „Jud Süß“ (1940), in: Alexandra Przyrembel / Jörg Schönert (Hrsg.), „Jud Süß“, Hofjude, literarische Figur, antisemitisches Zerrbild, Frankfurt, New York 2006, S. 201-220. [9] Vgl. Gunther Nickel / Johanna Schrön (Hrsg.), „Wenn man einen Schauspieler braucht, muss man ihn auch vom Galgen schneiden“. Die Spruchkammerakte Werner Krauß, in: Zuckmayer-Jahrbuch, hrsg. von Gunther Nickel, Erwin Rotermund und Hans Wagener, Bd. 6, 2003, S. 221-370. [10] Sibylle Lewitscharoff, Montgomery, Stuttgart, München 2003, S. 90 (alle weiteren Seitennachweise erfolgen in runden Klammern im Text. [11] Die Zeit, 20. März 2003. |
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |