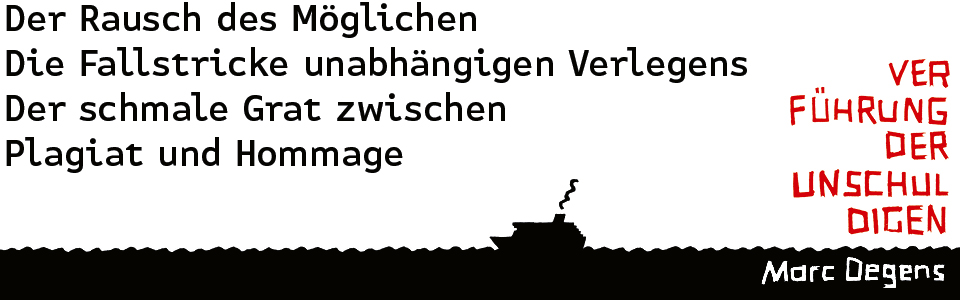
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
| April 2005 | Patrick Baumgärtel für satt.org |
|

| Andreas Maier: Kirillow
Semantische Totalverwirrung Andreas Maier überhebt sich an Gott, der Welt, der Globalisierung, der Jugend usw. Der Klappentext hilft wieder einmal auf die Sprünge: Um die Wirren der Adolenszenz ginge es im neuen Roman Andreas Maiers. Derlei Eindeutigkeit lässt der Roman selbst größtenteils vermissen. Die Jugend also! Das Stadium des Menschen, das nach Leopardi der Natur noch am nächsten und der Aufklärung am entferntesten stünde, in dem der Mensch der Welt gegenübergestellt wird und diese durch Fantasielosigkeit versagt, was nur bemerkt wird, sollte er "dieses Bohrende", "dieses nichts und niemanden in Ruhe Lassende" als Charakterzug besitzen, wie es bei den beiden entfremdeten Freunden Julian Nagel und Frank Kober der Fall zu sein scheint, wie Julians Schwester Anja einmal meint. Die Jugend in ihrer mutwilligen Orientierungslosigkeit, in ihrer hoffnungsbeladenen Schwermut, ihrer verwilderten Insolenz und ihrer funkensprühenden Realitätsverweigerung! Wie gut kann sie geeignet sein, unser hochkomplexes, adultes und illusionsbefreites Zeitalter zu beschreiben? Andreas Maier entwickelt "Kirillow" mit gewissem Grund aus dem Geist der Jugend. Spiegelt sich in dem unendlichen und ziellosen Nomadisieren von Kneipe zu Kneipe, der dekadenten Launigkeit und Sprunghaftigkeit, der unaufhörlichen Salbaderei Julians und seiner Freunde nicht die "semantische Totalverwirrung" wider, welche "die Welt in ihrem Gerede, in ihrem Blablabla, kurz: in ihrem Zustand" gefangen hält? Oder die sich hieraus ergebende Suche nach einem Ausweg? Oder umgekehrt? Ist die Handlung dieses Romans, die keine ist, nicht das Rätseln der Figuren über das, was nach Wittgenstein "der Fall" sein soll? Die Wirklichkeit ist aufgeteilt auf sechs Millarden Perspektiven, und es werden täglich mehr, eine kohärente Wahrheit lässt sich so wenig finden, wie dieser Roman nacherzählbar ist. Steht unsere hoch entwickelte Welt nicht seit jeher am Abgrund unserer pubertären erkenntnistheoretischen und politischen Unbedarftheit und Verantwortungslosigkeit? Haben wir die Castoren voll radioaktiven Materials, die in Gorleben für die nächsten dreißig Jahre in Kühlhallen "zwischengelagert" werden, wirklich im Griff? Sind die Kollegen des Landtagsabgeordneten Dr. Volker Nagel, des Vaters von Julian und Anja, denn wirklich so viel wissender als dessen Kinder? Der zweiundzwanzigjährige Julian stellt die Fragen, die im Moment von der Weltjugend gestellt werden, von Gruppen, die sich 'Angriff' nennen und die sich mit solchen Namen vor den Tristessen der postutopischen Welt schützen wollen, in die sie ohne es zu verlangen hineingeboren wurden. In der Auseinandersetzung mit dem sogenannten "Traktat über den Weltzustand" des Russen Andrej Kirillow suchen Julian und seine Freunde einen "Ausweg aus diesem totalitären System … von dem wir allerdings in letzter Zeit gerade begriffen haben, daß es kein System ist, und das gerade deshalb so totalitär ist." Sein Freund Jobst erkennt: "Wir leben auf Treibsand, von Anbeginn der Geschichte an. Mit jedem Versuch, herauszukommen, kommen wir immer tiefer hinein." Die Protagonisten Maiers gelangen mit russisch-großmeisterlicher Hilfe (Kirillow ist eine Figur aus Dostojewskis "Die Dämonen") zu einer Mixtur aus ökologischem Rousseauismus und christlicher Schuldverflochtenheit: Das Böse des Systems ist das Böse eines jeden Teilnehmers. Julian erkennt: Der Ausweg aus der globalisierten marktwirtschaftlichen Ausbeutung der Natur und der Errichtung einer "Risikogesellschaft", die ihre Kraft aus radioaktiven Brennstäben bezieht, ist nur in der Verneinung des blinden kapitalistischen Willens zum Leben zu finden, im Selbstmord. Schopenhauer für Globalisierungsgegner. Es entspricht der Logik dieses Buches, das die Logik seiner Protagonisten zum Vorwand nimmt, keiner Logik folgen zu müssen, dass die Freunde um Julian entgegen aller Fundamentalkritik aus Russland das "System" an seiner nächsten Nahtstelle angreifen, auf einem Atommülltransport in Gorleben. Bei dem Versuch, einen Selbstmordanschlag auf Polizisten zu verüben, kommt jedoch nicht Julian, sondern sein Freund Frank um. Sein Freund Jobst hatte Recht mit seiner pessimistischen Interpretation von Kirillows Traktat: Der Versuch der Befreiung resultiert in der weiteren Verstrickung in die Schuldzusammenhänge dieses Lebens. Frank Kober, das fünf Jahre ältere alter ego, hatte im Gegensatz zu der jugendlichen Radikalität Julians den Rückzug und die Sorge um den Einzelnen gelebt. Sein Alter mag ihm etwas mehr Gelassenheit verliehen haben; Julians Blick auf das Ganze war bei ihm dem Konkreten gewichen. "Kirillow" ist ein verstörender und betörender Roman, aber er kann letzten Endes nicht überzeugen. Er ist verstörend, weil er keine Angst vor der Berührung mit abstrakteren und aktuellen Problemen der Zeitgeschichte hat, weil er uns die dünne Eisfläche, auf der wir uns bewegen, vor Augen führt und weil er einzig im Tod die Lösung unserer Probleme sieht. Er ist betörend, weil Andreas Maier eine Sprache gefunden hat, die den Leser von Anfang bis Ende die pulsierende Zerrissenheit seiner Figuren und ihre Nähe zum Wahnsinn fühlen lässt, weil er auf lahme inquit-Formeln verzichtet und weil er mittels ständiger Perspektivwechsel eine so wunderbare Unsicherheit und Unschärfe in der Erzählweise vermittelt, dass es dem Leser vorkommen muss, als hätte er beim Lesen seine Brille vergessen. Der Roman muss letztendlich scheitern, weil er die psychische Verfasstheit seiner Protagonisten zum Vorwand nimmt, auf Bedeutung zu verzichten. Das ewige Blabla – vielleicht das Thema Maiers, dieses unermüdlichen Chronisten des Mündlichen –, das dieses Buch in Form und Inhalt ausmacht, taugt nicht für einen Roman von über dreihundert Seiten. Der Autor hat sich an der dostojewskischen Balance zwischen Unsinn und Tiefsinn, Stammtischgeschwafel und politischer Theorie überhoben. Die offensichtliche Banalität der gegenwärtigen politischen Situation taugt auch nur bedingt als Sinnzentrum eines Romans. In der Folge bleibt sich alles gleich, alles geschieht aus einer Laune heraus, und alles ist nur Beiwerk auf dem ewigen Pfad der Jugend zur Identitätsfindung: die Hinwendung zu einer Theorie der Globalisierung, zur ökologischen Bewegung, zum sozialen Engagement. Der Erzähler liefert seinen Horizont dem Erzählobjekt aus und der Leser bleibt am Ende wie Julian und seine Freunde verwirrt und enttäuscht zurück. |
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
