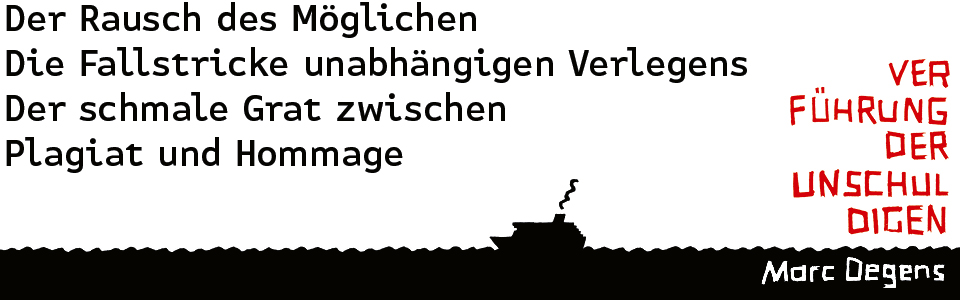Eduard Limonow:
Fuck off, Amerika
Kiepenheuer & Witsch 2004

278 S., 8,90 Euro
» amazon
|
|
Ein geniales Monstrum
"Fuck off, Amerika"
von Eduard Limonow
"Fuck off, Amerika", 1982 erstmals auf deutsch erschienen, ist der erste konsequent autobiographische Roman des sowjetischen Samisdat-Lyrikers Eduard Limonow, der in den 70er Jahren dem KGB offenbar zu populär und deshalb zur Emigration gezwungen wurde. Nach einer Zwischenstation in Wien lebte er eine Weile in New York, der Hauptstadt des Klassenfeindes, und von dieser Zeit erzählt sein Romandebüt. Einer Zeit der tiefen Kränkungen, der existentiellen Enttäuschung und Einsamkeit: er versteht die Sprache nicht, fühlt sich gesellschaftlich ausgestoßen, lebt von ein paar Wohlfahrt-Dollars, kommt ziemlich herunter, seine flatterhafte Frau läuft ihm davon, und – für den maßlosen Egozentriker die größte Beleidigung – kein Mensch interessiert sich für das lyrische "Genie". Und dabei glauben alle russischen Renegaten, und sie werden von den euphemistischen Sonntagsreden der Dissidenten noch in diesem Glauben bestärkt, "die Sowjetunion sei das Paradies der Mittelmäßigkeit, doch in Amerika wisse man Begabung zu schätzen. Welch ein Irrtum! Dort herrscht das ideologische Kalkül, hier das kommerzielle." Folgerichtig haßt Limonow den vermeintlich so meinungsfreien Westen mit einem Furor, wie er ihn für die UDSSR vermutlich niemals aufgebracht hat. Sein Roman, der sich streckenweise zu einem antikapitalistischen bzw. anarchistischen Pamphlet auswächst, ist also zunächst emotionaler Blitzableiter, zugleich aber auch ein aufrichtiges, sich selbst nie schonendes, die eigene Hybris, Ehrpusseligkeit und Larmoyanz nie beschönigendes Protokoll einer Selbstbehauptung. Limonow, nicht immer frei von Anfechtungen, macht sich gerade, beißt die Zähne zusammen, nimmt noch einen Schluck aus der Wodka-Flasche und verweigert jegliche Assimilation – im guten alten Anarchismus findet er dann zumindest ein ideologisches Zuhause: Wenn beide Systeme korrupt sind und nichts taugen, muß eben gleich die ganze Zivilisation über den Jordan gehen … Die Agitprop-Geschütze ballern ziemlich großkalibrig, beeindruckend ist jedoch eher die Genauigkeit, mit der Limonow die unterschiedlichen Milieus beschreibt, auf die so ein Verbannter wie er notwendig trifft: die eitle Künstler-Boheme, die wortreiche, aber tatenarme Salonlinke, die illusionslose Emigranten-Szene. Nirgendwo fühlt sich Limonow so richtig wohl, nur bei den Pennern, Kriminellen und Schwarzen, den anderen gesellschaftlichen Outcasts mithin, erfährt er Momente der Solidarität, Freundschaft, Zärtlichkeit. Daß er es für eine Weile nur mit Männern treibt, weil seine große Liebe ihn verlassen hat, und recht explizit davon zu berichten weiß, hat bei Erscheinen des Buches für Skandal gesorgt. Das war 1979! Seine Wiederauflage 2004 verdankt es wohl eher dem Anti-Amerikanismus, der gerade mal wieder Konjunktur hat. Als US-Haß-Klassiker taugt es allerdings nur wenig, denn Limonows Vorwürfe resultieren ja, er weiß das selber nur zu gut, vor allem aus seiner Maßlosigkeit und Egomanie. Sein Schicksal läßt sich nicht verallgemeinern. Er ist eben kein exemplarischer Fall – er ist Limonow, "die unmögliche Person", "ein geniales Monstrum", "der Nationalheld"! Und daß er in der in jüngeren Vergangenheit mehr durch rechtsradikales Posertum von sich Reden gemacht hat als durch eine Literatur, die der Rede wert wäre – so richtig überrascht einen auch das nicht.
|