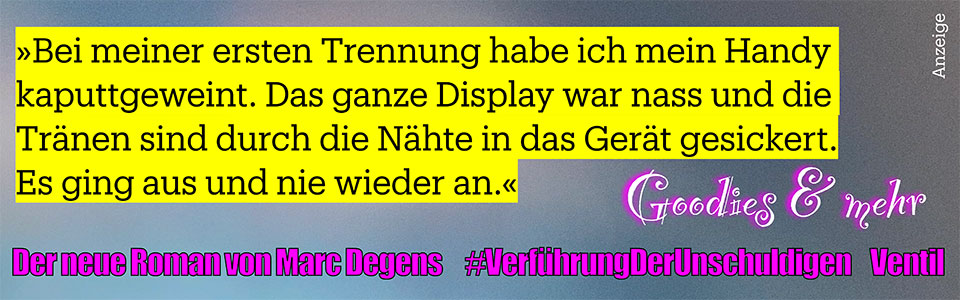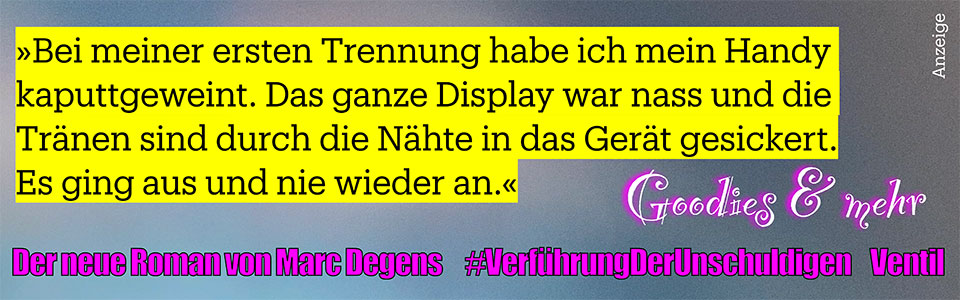Zwei verhinderte Detektive, ein Pole im Exil, ein Senator im Rollstuhl und die unwahrscheinliche Begegnung von Adolf Hitler und Franz Kafka sind die Ingredenzien von Ricardo Piglias Roman “Künstliche Atmung”. In Argentinien als Schriftsteller, Literaturkritiker, Dozent und Drehuchschreiber längst kein Unbekannter mehr, zählt der 1941 in einem Vorort von Buenos Aires geborene Piglia zu den wichtigsten Autoren der Generation nach Borges. Ein Ansehen, das er sich in erster Linie durch seinen 1980, zu Hochzeiten der Militärdiktatur, in Argentinien erschienenen Roman “Künstliche Atmung” verdient hat. Dieser Tage erscheint bei Wagenbach die von Sabine Giersberg sorgfältig vorgenommene Übertragung ins Deutsche.
In “Künstliche Atmung” schwirren zwei Detektive aus, um der Wahrheit der Geschichte auf die Spur zu kommen. Der Leser folgen ihnen auf ihren verschlungenen Pfaden und stößt dabei auf eine Vielzahl Anekdoten und Mikroerzählungen, welche zusammengenommen die Realität Argentiniens beschreiben.
Die Hauptfigur Emilio Renzi schreibt einen Roman über den Ehebruch seines Onkels, Marcelo Maggi. Dieser liest das Buch und protestiert prompt, weil er mit dessen Version seiner Geschichte nicht einverstanden ist. Marcelo Maggi wiederum arbeitet an einer Biographie einer Randgestalt der argentinischen Geschichte, Enrique Ossorio. Der Sekretärs des Caudillo Manuel Rosas beging ebenfalls einen Treuebruch, indem er an einer Verschwörung gegen Rosas teilnahm und daraufhin ins Exil gezwungen wurde.
Warum diese Dopplung des Plots wichtig ist, wird klar, wenn man sich die Zeitumstände in Erinnerung ruft, in denen Buch geschrieben wurde: Die Handlung setzt im April 1976 ein, ein Monat zuvor putschten in Argentinien die Militärs. Piglia selbst, wurde, als er Mitte 1977 aus dem Ausland ins Land zurückkehrte, vom Eindruck der Lähmung und Nicht-Kommunikation überwältigt. Nachdem auch noch Rodolfo Walsh, Mitarbeiter einer von Piglia herausgegebenen Krimiserie vom Regime verschleppt und ermordet wurde, war eins klar: Die freie Rede ist abgeschafft, wenn Piglia über die Zustände schreiben wollte, dann musste er es geschickt anstellen.
Der an Borges geschulte Piglia bedient sich einiger literarischer Kniffe, um die Zensur zu umgehen. Zum einen erscheint die Gegenwart (1979) im Roman als Projektion der Vergangenheit: In seinem New Yorker Exil schreibt Enrique Ossorio 1849 an einem utopischer Roman über das Argentinien 130 Jahre später. Zum anderen lässt Piglia Passagen des Romans, die auf den im realen 1979 stattfindenden Terror verweisen, in eine Diskussion um die Möglichkeit der Literatur nach Auschwitz einfließen. Ein im Text selbst eingebauter Zensor versucht zudem, versteckte Botschaften herauszufiltern. Eine implizite Aufforderung an den Leser, die Botschaften des Romans zu entschlüsseln.
Das literarische Sprechen wird so zu einem Drahtseilakt, der Künstler zu einem Tänzer auf einem gespannten Stacheldraht, wie es ein Gedicht im Buch ausdrückt. Spätestens hier wird deutlich, dass Verschachtelung und Zitat die wesentliche Kontruktionsprinzipien des Romans sind. Piglia schafft es aber, seinen Figuren Leben einzuhauchen, und den Leser immer wieder über die Brüche der Erzählung, die Zeitsprünge und Ortswechsel, hinwegzulocken.
Ein besondere Funktion erfüllen die atemlosen Dialoge, welche die bedrohliche Stimmung jener Zeit transportieren: Keine Zeit der Vertraulichkeiten, wie eine der Figuren resümiert. Man erzählt die Anekdoten der anderen und verrät nichts über sich. Renzi macht sich trotz der „widrigen Umstände” (sein Code für die Militärdiktatur) auf die Suche nach dem verschwundenen Maggi und nach der Wahrheit der Geschichte seines Onkels, Ossorios und Argentiniens.
Zwei von dessen letzten Gesprächspartner bringen Renzi bei seinen Nachforschungen weiter: Don Luciano Ossorio, Senator und Enkel Enriques, ein an den Rollstuhl gefesselter alter Mann, der seinen Zustand zur Metapher Argentiniens erklärt. Und Tardewski, ein Pole im argentinischen Exil und literarisches Denkmal für den Schriftsteller Witold Gombrowizc. Letzterer fühlt sich, seiner Muttersprache beraubt, ebenso amputiert wie der Greis und beschließt einen nur aus Zitaten bestehenden Roman zu verfassen. Renzi verbringt eine Nacht mit dem „falschen” Gombrowicz, und dieser dankt es ihm damit, dass er ihm die unwahrscheinliche Begegnung von Adolf Hitler und Franz Kafka schildert: Tardewski, auch er ein verhinderter Detektiv, meint in Kafkas Tagebuch Belege dafür gefunden zu haben, dass sich die beiden 1909 in einem Café in der Prager Meiselgasse trafen. Kafka habe aufmerksam den Delirien des gescheiterten Malers gelauscht, zuhause dann „In der Strafkolonie” geschrieben. Er sei sich sicher gewesen, dass das, was ihm Hitler in seinem schwer verständlichen Duktus mitteilte, eines Tages wahr werden würde, so dass er es in seiner Literatur vorwegnehmmen wollte. Hitler wird so zum literarischen Vorläufer Kafkas. Eine Verbindung, die wohl nur vom prekären Ort eines argentinischen Intelektuellen aus hergestellt werden kann, dessen Originalität darin besteht, auf originelle Weise zu kopieren. Eine Hypothese, die Borges vertrat, und deren Gelten für die argentinische Literatur in „Künstliche Atmung” an vielen Stellen vorgeführt wird.
Als makabere Fußnote der Geschichte bleibt nachzutragen, dass die Generäle ihre 1976 eingeleitete „nationale Reorganisation” ebenfalls Prozess nannten, und dieser dem vorgestellten Schrecken in Kafkas „Prozess” in nichts nachstand: „düstere Maschinerie einer Welt, in der alle angeklagt und schuldig sein können.”