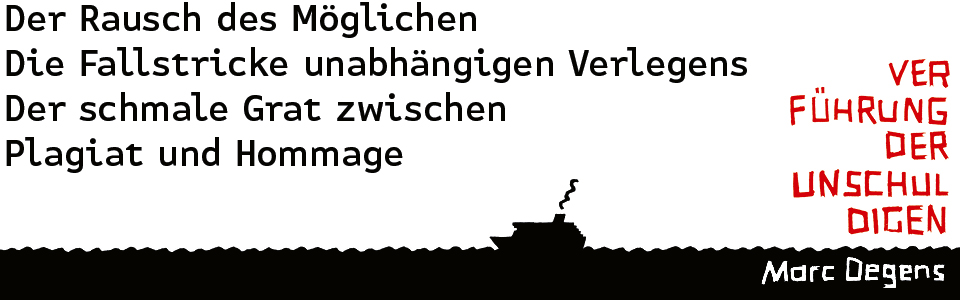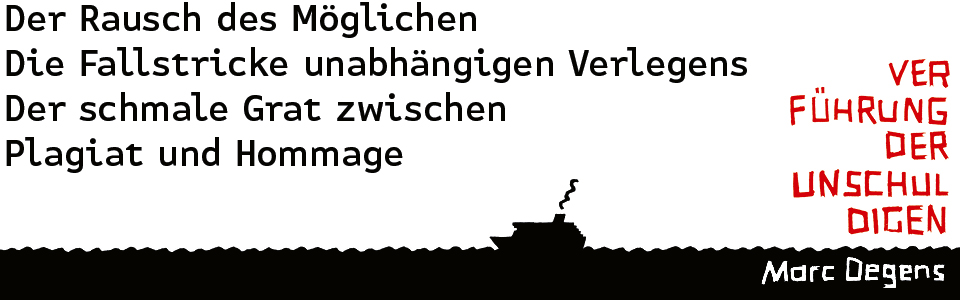Subversion zur Prime-Time
Die Simpsons und die Mythen der Gesellschaft
Im Vorwort zur zweiten Auflage wird ansatzweise erklärt, warum ein Buch, daß früher "Die Simpsons" hieß, nun nur noch "Subversion zur Prime-Time", den vorherigen Untertitel, auf dem Buchrücken trägt. Statt sich bei 20th Century Fox um die Zukunft von "Futurama" zu kümmern, liefert man sich lieber Schlammschlachten mit Kleinverlagen und neuseeländischen Brauereien, um dafür zu sorgen, daß niemand anders außer den rechtmäßigen Besitzern von der gelben Gelddruckmaschine aus Springfield profitiert.
Nun sind einige Fotos entfernt wurden, alle verbliebenen in streng wissenschaftlicher Zitiermanier mit Quellen versehen wurden, und vor allem wirbt man nicht mehr mit dem prominenten Konterfei von Homer und seinem Nachnamen in Großbuchstaben, sondern gibt sich ganz der Ernsthaftigkeit einer medienwissenschaftlichen Analyse hin, was aber den wahren Simpson-Fan auch nicht davon abhalten wird, sich das Buch zuzulegen.
In unterschiedlich ansprechenden Arbeiten über "temporäre Brüche in den Geschlechtsbildern" oder der "Entwicklung des soziopathischen Anticharakters im Cartoon" erfährt man vieles über das von Matt Groening erdachte Universum, dessen selbstreferenziellen Spielereien oder den politsatirischen Anspruch. Hierbei erschöpft man sich nicht nur darin, die mannigfaltigen Anspielungen insbesondere der späteren Staffeln der TV-Zeichentrickserie zu entschlüsseln, einige der Autoren entwickeln darüber hinaus auch interessante Theorien, die auf "ernsthaften" wissenschaftlichen Arbeiten von Adorno, Baudrillard oder Eco aufbauen. Doch dabei kommt der Spaßfaktor, den gerade ich als Donaldist zu schätzen weiß, nicht zu kurz.
Doch leider fehlt mitunter im Blendwerk der Fußnoten das nötige Basiswissen. Dies sind nur Kleinigkeiten, die das Fundament dieses empfehlenswerten Buches sicher nicht zum Bröckeln bringen, doch ich bin ja nicht umsonst bei meinen satt.org-Kollegen als "Korinthenkacker" verschrien. Wenn etwa im für mich interessantesten Kapitel, "Prügelviehzeug", die Vorväter der Simpsons mit der Zeichentrickhistorie innerhalb der Serie in Beziehung gebracht werden, bekam ich zunächst den Eindruck, daß Autor Thomas Klein es sich nicht verkneifen konnte, mit dem für die Arbeit fast völlig irrelevanten Tex Avery anzugeben, während er beim Thema "Tom & Jerry" und insbesondere bei seinen Ausführungen zum Roadrunner und Wile E. Coyote den kürzlich verstorbenen Chuck Jones schlichtweg zu erwähnen vergisst oder ihn einfach nicht kennt. Und wenn er dann nachher doch mal kurz Jones erwähnt, so verwirrt mich sein Vorgehen nur umso mehr.
Nachdem ich mich nun bereits als Donaldist geoutet habe, will ich mich auch nicht darin erschöpfen, die Parallelen zur Welt Donald Ducks zu erwähnen. Nein, viel gräulicher als die nur periphäre Erwähnung Carl Barks ist die Stelle, an der die Einwohner von Enternhausen mal ins Spiel gebracht werden. Daß man "Duckburg" nicht mit einem "h" am Schluß schreibt, übersehe ich geflissentlich, aber daß Mitherausgeber Michael Gruteser steif und fest behauptet, der amerikanische Name von Gustav Gans sei "Gusward Goose" oder die Panzerknacker kenne man in den Staaten als "Beetle Boys", treibt mir natürlich die Zornesröte ins Gesicht.
Wie soll ich bei solch groben Schnitzern noch Vertrauen in jene Aspekte des Buches haben, bei denen mir die Expertise fehlt? Ich kann nur hoffen, daß in der dritten Auflage solche Fehler verschwinden, das Kapitel zum Merchandise etwas schmaler wird und die Bildbelege im Kapitel "Topographia Americana" weniger aus Trading-Card-Serien, sondern aus der Fernsehserie stammen.
Nichtsdestotrotz ist "Subversion zur Prime-Time" das interessanteste, unterhaltsamste und ansprechendste Sekundärwerk, daß ich in diesem Jahr bisher gelesen habe, und ich kann es nur jedem Simpson-Fan wärmstens ans Herz legen.