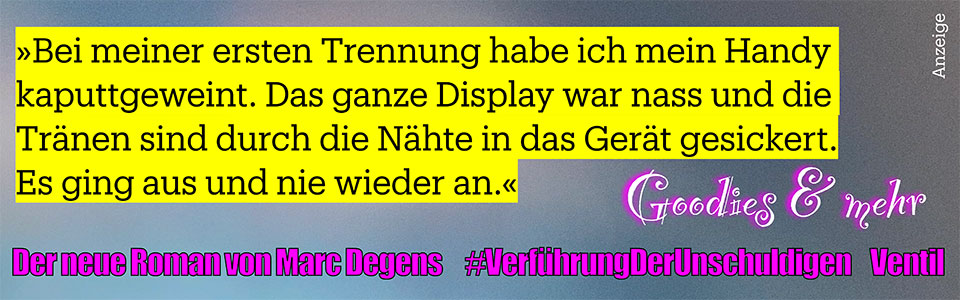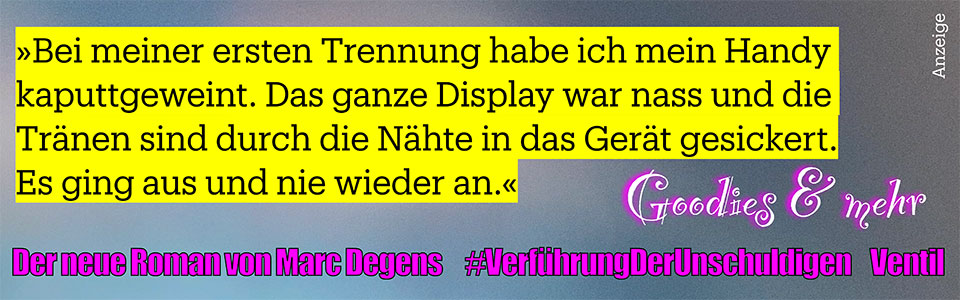Materialien zu einer Theorie des Interviews
0.
Das Interview ist die einzige Textgattung, die im 20. Jahrhundert erfunden wurde. Diesen Satz hörte man in letzter Zeit häufiger - wenn auch hinter vorgehaltener Hand. Denn noch fehlt es an Beschreibungen und Analysen, die die textuelle Struktur von Interviews offen legen und systematisieren und dadurch die Möglichkeit bieten würden, fundiert zu begründen, dass das Interview eigenständig und womöglich gleichberechtigt neben der Lyrik, dem Roman, dem Essay und dem Drama steht. Auch dieser Text wird eine solche Begründungsarbeit nicht leisten können; er versteht sich vielmehr als ein Plädoyer für eine differenzierte Wahrnehmung von Interviews als zu beschreibende und zu definierende Form menschlicher Äußerung auf der Schnittstelle von Stimme und Schrift. In dieser Hinsicht ist das Interview verwandt mit den beiden anderen Textgattungen, die man ebenso (polemisch) als genuine Erfindungen des 20. Jahrhunderts hinstellen könnte: Dem Hörspiel und dem Comic.
1.
Der Begriff "Interview" ist eine englische Erfindung, der aus dem französischen "entrevue" (verabredete Zusammenkunft), bzw. "entrevoir" (einander kurz sehen) hervorgegangen ist und im Deutschen recht bald, im Spanischen erst vor nicht allzu langer Zeit übernommen wurde ("interviú"). Im Französischen hingegen zieht man den Begriff "entretien" vor. Er steht für: Unterhaltung, Unterredung, Gespräch, Besprechung. Auch im Deutschen sind die Begriffe "Interview" und "Gespräch" nahezu synonym: so sind von sechs Interviews mit dem Dichter Thomas Kling, die sich im Internet finden lassen, drei mit "Gespräch" und drei mit "Interview" überschrieben.
Gespräche jedoch, die in publizierter Form auch Menschen zugänglich wurden, die nicht mit den Gesprächspartnern bekannt waren, gab es bereits im 19. Jahrhundert; das berühmteste Beispiel hierfür sind wohl Eckermanns "Gespräche mit Goethe". Das Interview aber, nennt man es auch Gespräch, entwickelt im 20. Jahrhundert zwei Merkmale, die es fundamental von allen Gesprächen, Konversationen und Dialogen aller vorangegangenen Zeiten unterscheiden: Es ist erstens kurz, meist nur wenige Seiten oder Minuten lang, und es ist zweitens aktuell, da es mit wenigen Ausnahmen an ein kurzlebiges Medium gebunden ist, sei’s eine Zeitung oder Zeitschrift, sei’s das Radio oder Fernsehen.
Manche Texte geben sich auch als Gespräch aus, stellen sich dann aber lediglich als Zusammenfassung eines Gespräches heraus, wobei häufig offen bleibt, ob es sich dabei um ein persönlich geführtes Gespräch handelt oder ob der Verfasser des Textes von einer Pressekonferenz berichtet oder sich auf Agenturnachrichten bezieht.
Der Begriff Interview, wie er in der Sozialforschung gebraucht wird, ist noch einmal ein anderer und eher gleichzusetzen mit "Befragung" oder "Umfrage", wobei die Fragen zumeist standarisiert, die Antworten also immer einem bestimmten Schema unterworfen sind. In der Psychoanalyse ist das Frage-Antwort-Schema flexibler, dient es doch schließlich therapeutischen Zwecken. Da der Patient (= der Interviewte) in diesem Schema derjenige ist, für den die Antworten von Interesse sind und die Publikation eines therapeutischen Gesprächs lediglich für die Fortbildung von Psychologen, Psychotherapeuten, etc. genutzt wird, soll diese Form hier, ebenso wie das starre und standarisierte Interview der Sozialforschung, unbeachtet bleiben.
Da das Interview, wie es hier verstanden wird, abhängig ist von seiner Aktualität, d.h. von seinem Zeitbezug, besteht die Notwendigkeit einer schnellen Publikation. So kann es gar nicht anders sein, als dass sich das Interview erst zu Anfang des 20. Jahrhunderts zu dem entwickelte, als das wir es heute kennen: Um Aktualität zu gewährleisten, ist eine schnelle Datenübermittlung notwenig, wie sie erstmals die Telegraphie bot. Außerdem war ein Medium nötig, dass ein breites Publikum erreichen konnte, damit das Interview einerseits für Politiker aus Gründen der Selbstdarstellung interessant wurde und andererseits Figuren aus dem Gesellschafts- und Geistesleben für das Publikum an Attraktivität gewannen. Wer war schon bereit, viel Geld für ein Buch auszugeben, wenn nicht auch wirklich ein Buch, sondern eine läppische Unterhaltung, wie man sie auch mit dem Nachbarn führen konnte, darin zu finden war? Erst in den letzten Jahren werden in zunehmendem Maße Interviews in Buchform verbreitet. Dass dies der Fall ist, lässt darauf schließen, dass das Interview in zunehmendem Maße als eine eigenständige Textgattung wahrgenommen und etabliert wird.
Günstig und in großer Menge Zeitschriften und Zeitschriften zu publizieren war erst im Laufe des 19. Jahrhunderts möglich geworden. Noch länger dauerte es, bis Kino und Radio einer signifikanten Menge von Zuschauern und Hörern zugänglich wurden. Bedeutend für den Aufstieg des Interviews war ebenso sehr wie die Erfindung der Telegraphie und des Schnelldrucks die Erfindung des Grammophons, bzw. des Tonbandgeräts und damit die Möglichkeit der präzisen Konservierung von O-Tönen. Nur so war die Programmgestaltung im Radio unabhängig von Studiogästen und der Tonfilm überhaupt erst denkbar. Außerdem verlor die fehleranfällige Stenographie an Bedeutung und der Journalist an Freiraum.
2.
Die Journalisten haben Genua heute verlassen und sind 30 heiße Kilometer nach Rapallo gefahren, um die sowjetische Delegation zu sehen und Georgij Tschitscherin zu interviewen. Tschitscherin, blond und in neuen Berliner Anzügen mit einem großen rechteckigen roten Abzeichen, sieht aus wie ein Geschäftsmann. Er spricht wegen seiner Zahnlücken mit einem leichten Schnurren. Er empfing die Flut der Reporter schubweise und redete mit jedem in seiner Sprache. Hunderte von Fotografen versuchten an den Wachtposten vorbeizukommen, die ihre Kameras nach Bomben untersuchten.
Dieser Ausschnitt aus einem Artikel, den Hemingway am 10.4.1922 von der Genua-Konferenz an den Toronto Daily Star kabelte, ist der erste mir bekannte Interview-Metatext. Es zeigt, dass sich das Politiker-Interview der zwanziger Jahre - in seinem Ablauf - kaum von dem heutigen unterscheidet. Es legt nahe, dass sich die Form des Politiker-Interviews nicht über einen längeren Zeitraum entwickelt hat, sondern geradezu plötzlich seine eigene Gestalt gewann.
Der Artikel Hemingways zeigt auch, dass die Gattung des Interviews keine allein der Schrift verpflichtete Textgattung ist. Kaum ein Interview, ob mit einem Politiker, Wissenschaftler oder Künstler, kommt ohne das kaum ältere Medium der Fotografie aus. Im Kino und TV sind es die bewegten Bilder, die das Interview illustrieren, in Zeitungen und Zeitschriften sind es zumeist Momentaufnahmen, die den Interviewten während des Interviews abbilden; allein das Radiointerview muss immer ohne diese visuelle Komponente auskommen. Das Foto ist keine bloße Beigabe zum Text. Schon vor dem zweiten Weltkrieg entschied Aussehen und Auftreten des Politikers über seinen Erfolg bei den Wählern. Das Aussehen eines Autors, dessen Bücher zu einem Gutteil mit Interviews beworben werden, kann für den Verkaufserfolg entscheidend sein. Schon Baudelaire erkannte die Fotografie als geeignetes Medium zur Selbstdarstellung und auch Brecht liebte die fotografische Pose.
Häufig stellt sich auch der gedruckte Interview-Text selber nicht als reines Gespräch dar: Zwischentexte geben Erläuterungen was bestimmte Sachverhalte angeht - dies kann von einer kurzen Begriffserklärung bis zu eingeschobenen Absätzen über die Biographie des Interviewten o.ä. reichen - oder vermitteln Details der Gesprächssituation, die dem Leser Unmittelbarkeit und Authentizität suggerieren sollen, wie etwa "Sie lachte" oder "Er hustet".
Nach wie vor schwebt das Interview in einem Raum zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit und wird aufgrund dieser Zwitternatur aus dem wissenschaftlichen Diskurs ausgegrenzt: erst wenn der Interviewte das, was er ausgesagt hat, zwischen zwei Buchdeckel gebracht hat, wird es zu einem ernstzunehmenden Text. So haftet dem Interview auch etwas Unverbindliches an. Innerhalb des politischen Diskurses hat die Rede allerdings einen geradezu entgegengesetzten Status inne, weswegen die Entwicklung der Politik auch in nicht unbeträchtlichem Maße von Interviews bestimmt wird. Neuerungen und Neuigkeiten aus dem Bereich der Politik und der Wirtschaft werden in zunehmendem Maße erstmals im Interview öffentlich gemacht. Geht es aber darum ästhetische oder wissenschaftliche Positionen zu formulieren, so ist das Interview nur ein Ort des Resümees, der Revision, bestenfalls des Nachtrags.
3.
Das in Zeitungen oder Zeitschriften abgedruckte Interview erscheint mir als das seiner Form nach originäre, als das Interview schlechthin. Auch wenn dadurch der Schrift einmal mehr das Primat zugewiesen wird, so sprechen doch Frequenz und Funktionalität für diese These (außerdem wurde schon auf die Rolle der Fotografie hingewiesen, die die Sonderstellung des gedruckten Wortes relativiert). In jeder beliebigen Tageszeitung finden sich täglich leicht bis zu drei Interviews, selbstverständlich auf unterschiedliche Ressorts verteilt. Im Fernsehen hingegen sind Interviews, von sogenannten Statements in den Nachrichten abgesehen, eher selten. Zwar wird eine große Anzahl von Talkshows ausgestrahlt, die ich aber aus zwei Gründen nur eingeschränkt zur Gattung des Interviews zählen will. Erstens aufgrund der Zahl der Teilnehmer. Nicht um die einzelne Person geht es hier (auch wenn die Personen einzeln befragt werden), sondern um das allgemeine und vorgegebene Thema. Talkshows sind nicht flexibel, was ihr Thema angeht (dies wäre vielleicht Grund eineinhalb). Bei einer Vielzahl von Teilnehmern ist das vorgegebene Thema so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner: Der Interviewer, den man hier wohl Moderator nennen muss, kann nicht von der Biographie zu Fragen der Ausländerpolitik und von dort zu schriftstellerischen Plänen übergehen, da er damit Gefahr läuft, eine große Zahl der Teilnehmer von der Diskussion auszugrenzen. Die Teilnehmer an einer Diskussion haben eine weitaus aktivere Rolle als der Interviewte im traditionellen Einzelinterview: Sie können ungefragt in die Diskussion eingreifen und auch selbst Fragen stellen. In dieser Hinsicht ist die Talkshow flexibler als das gedruckte Interview, bei dem niemals ein Wechsel der Frageposition stattfindet; die Fragen, die der hier Interviewte stellt, bleiben fast immer rhetorisch.
Zweitens finden sich in den meisten nachmittäglichen Talkshows keine professionellen Interviewten. Insofern unterscheidet sich eine Talkshow grundlegend von jedem anderen Interview: Die Interviewten haben noch nie an einem solchen Text mitgearbeitet, können ihn deswegen nur schwer handhaben. Bevor sie noch die Technik erlernt haben, ist das Interview schon vorbei. Politiker sind das Gegenteil davon. Sie werden derart häufig befragt, dass sie im Besitz von Standartlösungen sind, d.h. eine strukturelle Fähigkeit entwickelt haben, die sie vor Angriffen schützt, und ihnen ermöglicht schnell und unversehrt ein Interview zu bewältigen. Das Interview ist hier nicht fähig einen Lust- oder Spieltrieb im Interviewten oder im Zuschauer zu entwickeln. Es geht vordergründig um faktische Information. Tatsächlich aber zeigt jedes neue Interview mit Menschen, die sich von Berufs wegen mit Fragen von Journalisten auseinander zu setzten haben, dass die interviewte Person noch die alte geblieben ist. Das Interview ist kein Ort der Veränderung und die entscheidende Information, die transportiert wird ist: Er wird seinem Image gerecht.
Selbstverständlich gibt es auch noch die Talkshows, an denen ausschließlich "Professionelle" teilnehmen. Eine solche Gesprächs-, bzw. Diskussionsrunde (mit Politikern, Künstlern, Wissenschaftlern) ist wahrscheinlich die komplexeste Form innerhalb der Gattung Interview. Die Teilnehmer sind eigenständige Interview-Persönlichkeiten. Jeder versucht seinen eigenen Text fortzuschreiben, seinen eigenen Stil durchzusetzen und unterliegt also einer permanenten "Einflussangst". Im Widerstreit der unterschiedlichen Textstrategien ist der Moderator der eigentliche Textregisseur. Es obliegt ihm, die einzelnen Textschichten als solche koordinieren - sie zu verschmelzen ist erfahrungsgemäß unmöglich. Sie also vor der gegenseitigen Abstoßung, dem Zerfall zu bewahren ist seine Aufgabe. Diese wird häufig nicht erfüllt, da nicht allen Moderatoren klar ist, dass im Idealfall nichts anderes möglich ist, als einen hybriden Text zu schaffen: Ein gemeinsamer Nenner ist hier nicht zu erzielen, ein Erfolg ist es, wenn es gelingt, die unterschiedlichen Positionen auszudifferenzieren.
Die Talkshow bewahrt zudem das Auge des Zuschauers vor Langeweile: Durch die Vielzahl der Interviewten hat die Kamera die Möglichkeit in hoher Frequenz unterschiedliche Bilder einzufangen. Deswegen ist das Fernsehinterview mit lediglich einem Interviewten auch so problematisch: Geht es dem Zuschauer tatsächlich um die Antworten und nicht um die Erscheinung des Interviewten, dann wird er zum bloßen Zuhörer, seine Augen schweifen ab und er fühlt sich gelangweilt, obwohl er bekommt, was er will: den Text, jedoch im falschen Medium.
Das gedruckte Interview hingegen hält das lesende Auge ständig in Bewegung. Die beigefügten Bilder dienen hier weniger der Illustration, als vielmehr dazu, dem Auge einen Ruhepunkt zu bieten, der ganz nach Belieben eingenommen werden kann.
Häufig folgt das Interview keiner linearen Erzählung. Es springt von einer Erzählung zur nächsten, kommt von der Biographie des Interviewten zu seinen Ideen, Meinungen, Auffassungen, von seiner Idee die Kernspaltung betreffend zu seiner Meinung über das Fortleben von Opernhäusern zu seiner Auffassung von Kindererziehung. Hier zeigt sich der metatextuelle Charakter des Interviews am deutlichsten.
Ziel des Interviewers ist es, den Interviewten soweit zum Sprechen zu bringen, dass kurze Einwürfe genügen, um den Textfluss am Laufen zu halten. Kommt es tatsächlich so weit, besteht allerdings die Gefahr von Monotonie: Man liest schließlich kein Interview, um eine Geschichte zu lesen. Im Grunde will man, dass der Text, aus dem sich der Interviewte für den Leser zusammensetzt, aufgebrochen wird. Das Interview soll Textstrategien offen legen. Inhalte zu hinterfragen bedeutet gleichzeitig, Sprechweisen zu hinterfragen. Der zentrale Unterschied zwischen dem Interview und anderen Textsorten ist wahrscheinlich das Frage-Element. Das Antwort-Element ist noch aus anderen Textsorten übernommen. Die Frage aber ist Terrorist. In jedem Fall hebt sie das Primat der Antwort auf: Der Zweifel am eigenen Text ist dem Interview eingeschrieben.
Im Wechselspiel von Frage und Antwort liegt auch der Unterschied zwischen Interview und Gespräch begründet. Das Interview ist eine Einbahnstraße, denn die Fragen sind immer in dieselbe Richtung gestellt. Im Gespräch aber sind alle Teilnehmer zugleich Fragensteller und Antwortgeber. Ein Gespräch ist nur unter der Vereinbarung möglich: Keiner ist interessanter als der andere (was beispielsweise für ein Gespräch zwischen Durs Grünbein und Aris Fioretos gilt). Die Talkshow, bzw. die Diskussionsrunde, ob im Fernsehen oder einem anderen Medium ist, eine ausgeprägte Mischform aus Interview und Gespräch: Ein Moderator stellt zwar Fragen wie ein Interviewer, diese Fragen aber haben zugleich vermittelnde Funktion. Sie dienen ebenso wie zum Informationsgewinn dem Funktionieren eines Gesprächs.
4.
Die beherrschende Frage einer Theorie des Interviews wird wahrscheinlich darin bestehen, inwieweit das Interview Authentizität simuliert (da das Interview vermittelt werden muss, ist Authentizität per definitionem nicht möglich). Es geht bei dieser Frage darum, inwieweit eine Nachbearbeitung vor der Publikation stattfindet. Vor allem Nachbearbeitungen des Stils und des Umfangs, die sich für den Leser nicht nachvollziehen lassen, lassen jedes Interview fragwürdig erscheinen. Sensible Naturen werden sich schon durch einen korrigierten falschen Konjunktiv betrogen fühlen, ästhetische Naturen werden vielleicht dann verletzt, wenn der falsche Konjunktiv nicht korrigiert wurde. Dass Interviews auf die vermeintlich interessantesten Passagen zusammengeschnitten werden kann nicht überraschen, höchstens Partynaturen betrüben, die alle Interview-Langweiler entlarvt wissen wollen.
Wieweit kann die Aura des Authentischen, die das Interview umgibt, noch aufrechterhalten werden, wenn es zu einem späteren Zeitpunkt in Buchform publiziert wird (wie etwa die Interviews mit Heiner Müller, die seinen gesammelten Werken beigegeben werden)? Und wie ist es um die Authentizität von Interviews bestellt, wenn ihre Anordnung in einem Sammelband den Eindruck erweckt, sie würden einem fortlaufenden Plan entsprechen (wie etwa die von Fritz R. Raddatz zuerst für die "Zeit" geführten und dann bei Suhrkamp veröffentlichten Interviews)?
In einem Interview, dass Reinhard Priessnitz mit Arnulf Rainer führte ("am 23 februar 1969 vormittags"), wird versucht sich einem Maximum an Authentizität der Darstellung zu nähern, indem die Zwischenstufe der Transkription des Gesprochenen als mögliche Fehlerquelle ausschaltet wird und die Fragen und Antworten direkt auf dem Papier formuliert werden. Ein Tonband dient dazu, Ausbrüche aus diesem System zu dokumentieren. Graphisch sind geschriebener und gesprochener Interviewteil voneinander abgehoben. Selbstverständlich droht in einem solchen Fall der geschriebene Teil in die Gattung des literarischen Briefes überzutreten und der gesprochene in die Banalität:
priessnitz: hast du vielleicht fruchtsaft?
rainer: ja, cappy’.